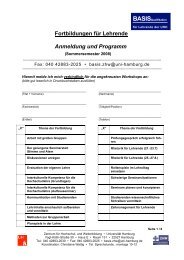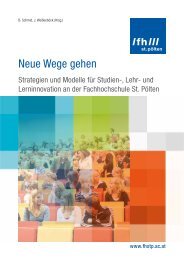“Gibt es eine Net Generation?” (PDF) - ZHW - Universität Hamburg
“Gibt es eine Net Generation?” (PDF) - ZHW - Universität Hamburg
“Gibt es eine Net Generation?” (PDF) - ZHW - Universität Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Medien-Nutzungsmotive<br />
Da das Kriterium »Mediennutzung« offensichtlich nicht geeignet ist, die Existenzbehauptung<br />
der <strong>Net</strong>zgeneration zu beweisen, vielleicht lassen sich dann die Einstellungen<br />
nachweisen, die den <strong>Net</strong> Kids nachg<strong>es</strong>agt werden. Ideologische Zuschreibungen für<br />
das, was »hellsichtige« Schreiber wie Prensky, Oblinger & Oblinger, Howe & Strauss<br />
unter Digital Nativ<strong>es</strong> oder <strong>Net</strong> <strong>Generation</strong> verstehen, finden sich viele. Harmlos sch<strong>eine</strong>n<br />
noch Attribuierungen der folgenden Art zu sein: <strong>Net</strong> Geners seien vertraut mit<br />
Computern, sie seien ausg<strong>es</strong>prochen optimistisch, hätten Lust und Inter<strong>es</strong>se an Kommunikation<br />
und Computerspielen. Weniger harmlos hingegen sind die durch k<strong>eine</strong> methodische<br />
Forschung belegten Zuschreibungen wie: <strong>Net</strong> Geners ziehen Gruppenarbeit<br />
vor, präferieren Lernen durch Tun und induktiv<strong>es</strong> entdeckend<strong>es</strong> Lernen, bevorzugen bebildert<strong>es</strong><br />
Lernmaterial und Interaktivität, zeigen Leistungsorientierung, sind emotional<br />
offen und zeigen ihre Gefühle, sind visuelle Lerner, sind offen für Diversität und verfügen<br />
nur über kurze Aufmerksamkeitsspannen.<br />
Man wird ohne direkte Untersuchung der Jugendlichen derartige Behauptungen weder<br />
nachweisen noch widerlegen können. Aber wir können indirekt aus zwei methodischen<br />
Zugängen di<strong>es</strong><strong>es</strong> Thema etwas solider diskutieren: Zum <strong>eine</strong>n gibt <strong>es</strong> einige Daten zu<br />
Präferenzen der Jugendlichen bei der Mediennutzung, speziell der Computernutzung,<br />
zum anderen gibt <strong>es</strong> Erhebungen, die den Altersverlauf der Präferenzen transparent machen,<br />
so dass man ersehen kann, wie sich mit zunehmendem Alter die Einstellungen<br />
und Vorlieben ändern.<br />
Ich folge dabei der Hypoth<strong>es</strong>e, dass nicht die Medien selbst und nicht einmal die Inhaltsangebote<br />
in den Medien den Nutzer veranlassen, b<strong>es</strong>timmte Gewohnheiten anzunehmen,<br />
sondern dass die Motivation der Nutzer darauf zielt, eigene Bedürfnisse zu<br />
befriedigen und sich zu dem Zweck b<strong>es</strong>timmter Medien bedient. Di<strong>es</strong>e Hypoth<strong>es</strong>e steht<br />
in Übereinstimmung zum Us<strong>es</strong>-and-Gratification-Ansatz (Blumler & Katz 1974; Rubin<br />
2002; s. den gründlichen Überblick bei Schweiger 2007, S. 60-91): »Die aktive Medienselektion<br />
erfolgt immer funktional und dient der Erreichung gewünschter Wirkungen.<br />
Die beiden wichtigsten Bedürfnisse sind das Informations- und das Unterhaltungsbedürfnis.<br />
Wenn Menschen Medien nutzen, dann muss mind<strong>es</strong>tens ein persönlicher<br />
Grund für di<strong>es</strong><strong>es</strong> Verhalten existieren.« (vgl. Treumann, Meister, Sander u.a. 2007, S.<br />
36ff., S. 112) Die Rolle der Motive bedeutet nicht, dass die Bedürfnisse dem Individuum<br />
bewusst oder gar reflektiert sein müssen, sie sind durch die vorangegangene Sozialisation<br />
gewachsen.<br />
Es gibt viele Motivationstheorien in der Psychologie, die für unterschiedliche Kontexte<br />
entwickelt worden sind. Schweiger (2007) diskutiert einige von ihnen im Kontext d<strong>es</strong><br />
Us<strong>es</strong>-and-Gratification-Ansatz<strong>es</strong>. Wie wir an den Daten, die in di<strong>es</strong>em Kapitel referiert<br />
werden, noch sehen werden, spielt neben den genannten Informations- und Unterhaltungsbedürfnissen<br />
das Kontakt- und Kommunikationsbedürfnis <strong>eine</strong> zunehmend gewichtige<br />
Rolle für die Jugendlichen, das dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit<br />
entspricht, wie <strong>es</strong> in der Selbstb<strong>es</strong>timmungstheorie von Deci und Ryan (1985) modelliert<br />
wurde, deren Modell auf drei Faktoren basiert und sich d<strong>es</strong>halb gut für erklärende