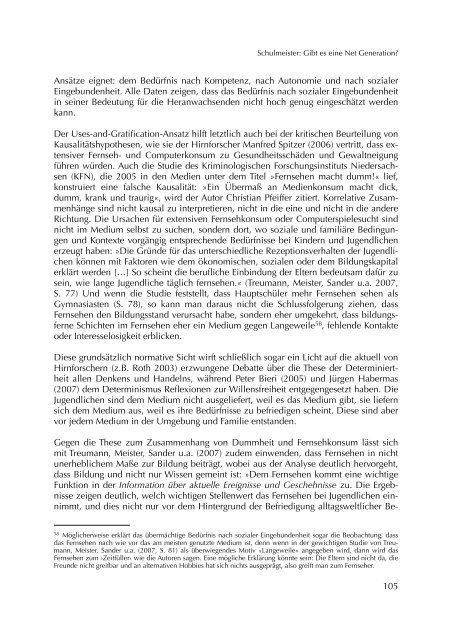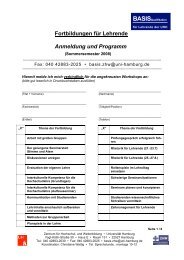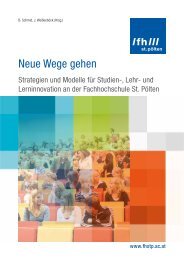“Gibt es eine Net Generation?” (PDF) - ZHW - Universität Hamburg
“Gibt es eine Net Generation?” (PDF) - ZHW - Universität Hamburg
“Gibt es eine Net Generation?” (PDF) - ZHW - Universität Hamburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schulmeister: Gibt <strong>es</strong> <strong>eine</strong> <strong>Net</strong> <strong>Generation</strong>?<br />
Ansätze eignet: dem Bedürfnis nach Kompetenz, nach Autonomie und nach sozialer<br />
Eingebundenheit. Alle Daten zeigen, dass das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit<br />
in s<strong>eine</strong>r Bedeutung für die Heranwachsenden nicht hoch genug eing<strong>es</strong>chätzt werden<br />
kann.<br />
Der Us<strong>es</strong>-and-Gratification-Ansatz hilft letztlich auch bei der kritischen Beurteilung von<br />
Kausalitätshypoth<strong>es</strong>en, wie sie der Hirnforscher Manfred Spitzer (2006) vertritt, dass extensiver<br />
Fernseh- und Computerkonsum zu G<strong>es</strong>undheitsschäden und Gewaltneigung<br />
führen würden. Auch die Studie d<strong>es</strong> Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen<br />
(KFN), die 2005 in den Medien unter dem Titel »Fernsehen macht dumm!« lief,<br />
konstruiert <strong>eine</strong> falsche Kausalität: »Ein Übermaß an Medienkonsum macht dick,<br />
dumm, krank und traurig«, wird der Autor Christian Pfeiffer zitiert. Korrelative Zusammenhänge<br />
sind nicht kausal zu interpretieren, nicht in die <strong>eine</strong> und nicht in die andere<br />
Richtung. Die Ursachen für extensiven Fernsehkonsum oder Computerspiel<strong>es</strong>ucht sind<br />
nicht im Medium selbst zu suchen, sondern dort, wo soziale und familiäre Bedingungen<br />
und Kontexte vorgängig entsprechende Bedürfnisse bei Kindern und Jugendlichen<br />
erzeugt haben: »Die Gründe für das unterschiedliche Rezeptionsverhalten der Jugendlichen<br />
können mit Faktoren wie dem ökonomischen, sozialen oder dem Bildungskapital<br />
erklärt werden […] So scheint die berufliche Einbindung der Eltern bedeutsam dafür zu<br />
sein, wie lange Jugendliche täglich fernsehen.« (Treumann, Meister, Sander u.a. 2007,<br />
S. 77) Und wenn die Studie f<strong>es</strong>tstellt, dass Hauptschüler mehr Fernsehen sehen als<br />
Gymnasiasten (S. 78), so kann man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass<br />
Fernsehen den Bildungsstand verursacht habe, sondern eher umgekehrt, dass bildungsferne<br />
Schichten im Fernsehen eher ein Medium gegen Langeweile 58 , fehlende Kontakte<br />
oder Inter<strong>es</strong>selosigkeit erblicken.<br />
Di<strong>es</strong>e grundsätzlich normative Sicht wirft schließlich sogar ein Licht auf die aktuell von<br />
Hirnforschern (z.B. Roth 2003) erzwungene Debatte über die Th<strong>es</strong>e der Determiniertheit<br />
allen Denkens und Handelns, während Peter Bieri (2005) und Jürgen Habermas<br />
(2007) dem Determinismus Reflexionen zur Willensfreiheit entgegeng<strong>es</strong>etzt haben. Die<br />
Jugendlichen sind dem Medium nicht ausgeliefert, weil <strong>es</strong> das Medium gibt, sie liefern<br />
sich dem Medium aus, weil <strong>es</strong> ihre Bedürfnisse zu befriedigen scheint. Di<strong>es</strong>e sind aber<br />
vor jedem Medium in der Umgebung und Familie entstanden.<br />
Gegen die Th<strong>es</strong>e zum Zusammenhang von Dummheit und Fernsehkonsum lässt sich<br />
mit Treumann, Meister, Sander u.a. (2007) zudem einwenden, dass Fernsehen in nicht<br />
unerheblichem Maße zur Bildung beiträgt, wobei aus der Analyse deutlich hervorgeht,<br />
dass Bildung und nicht nur Wissen gemeint ist: »Dem Fernsehen kommt <strong>eine</strong> wichtige<br />
Funktion in der Information über aktuelle Ereignisse und G<strong>es</strong>chehnisse zu. Die Ergebnisse<br />
zeigen deutlich, welch wichtigen Stellenwert das Fernsehen bei Jugendlichen einnimmt,<br />
und di<strong>es</strong> nicht nur vor dem Hintergrund der Befriedigung alltagsweltlicher Be-<br />
58 Möglicherweise erklärt das übermächtige Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit sogar die Beobachtung, dass<br />
das Fernsehen nach wie vor das am meisten genutzte Medium ist, denn wenn in der gewichtigen Studie von Treumann,<br />
Meister, Sander u.a. (2007, S. 81) als überwiegend<strong>es</strong> Motiv »Langeweile« angegeben wird, dann wird das<br />
Fernsehen zum ›Zeitfüller‹ wie die Autoren sagen. Eine mögliche Erklärung könnte sein: Die Eltern sind nicht da, die<br />
Freunde nicht greifbar und an alternativen Hobbi<strong>es</strong> hat sich nichts ausgeprägt, also greift man zum Fernseher.<br />
105