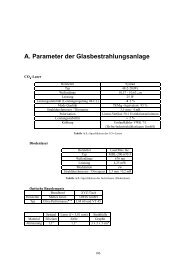Titel und Vorspann-1 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Titel und Vorspann-1 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Titel und Vorspann-1 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
117<br />
Das nächste Deckenbild bezeichnet Müller 718 1924 als „Bergpredigt“. 719 Ingrid Schulzes<br />
Deutung als „Speisung der Fünftausend“ ist allerdings eher nachvollziehbar. Völker zeigt<br />
Christus im Disput, der sich wohl auf die Möglichkeit einer Speisung so vieler Menschen<br />
bezieht. Die spannende Staffelung der Figuren stellt die ungeheure Menschenmenge<br />
überzeugend dar. Den Vordergr<strong>und</strong> beherrschen zwei sich gegenüberstehende<br />
Figurengruppen, die durch die Anordnung der Personen das langgestreckte Format<br />
unterstreichen.<br />
Das nächste Bild „Christus <strong>und</strong> die Ehebrecherin“ zeigt im Hintergr<strong>und</strong> eine unwirklich<br />
erscheinende Kulisse, die sich weder als Architektur noch als Landschaft beschreiben<br />
lässt. Im Vordergr<strong>und</strong> ist die Kontroverse zwischen Christus <strong>und</strong> den Pharisäern<br />
dargestellt. Die Sünderin sinkt vor Christus, der eine Hand schützend über ihren Kopf hält,<br />
auf die Knie <strong>und</strong> greift nach seiner anderen Hand. Der Arm ist überlängt dargestellt, als ob<br />
Christus eben noch die Worte „Wer unter Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten<br />
Stein“ in den Sand geschrieben hätte. Die Gesichter <strong>und</strong> Haltungen, hier vor allem der<br />
grün gewandeten Figur, die mit dem Finger auf die Frau zeigt, <strong>und</strong> die anderen Personen<br />
drücken ein breites Spektrum an Gefühlen aus. Erbostheit steht neben Anklage oder<br />
einem stummen Interesse.<br />
Die Deckenbilder mit ihrem leuchtenden Blau, Grün, Rot <strong>und</strong> dem tiefen Braun sind<br />
wesentlicher Teil der Gestaltung des Raumes. Dunkelgrün <strong>und</strong> Goldorange ergänzen die<br />
Farben <strong>und</strong> fanden für die Malereien am Kanzelaltar, die Farbfassung der<br />
Hufeisenempore, der Orgel <strong>und</strong> der Kirchenbänke Verwendung. Die vorhandenen älteren<br />
Malereien am Kanzelkorb <strong>und</strong> an den Brüstungsfeldern der Empore band der Künstler<br />
geschickt ein, freie Felder an den Emporen wurden mit Blüten in expressionistischer<br />
Formensprache geschmückt. Ganz ähnliche Blüten befanden sich auf der im selben Jahr<br />
bemalten Kassettendecke im Alten Rathaus in <strong>Halle</strong>. Durch die gestalterische Änderung<br />
an den Seitenteilen des Kanzelaltars konnte die vorher strenge, gerade Form schwungvoll<br />
aufgelöst werden. 720 Bemalt sind hier die Flächen mit an einen Lebensbaum erinnernden<br />
kräftigen grünen Pflanzen auf gelborangenem Gr<strong>und</strong>. Sie wachsen in kühnen Schwüngen<br />
empor, verzweigen sich <strong>und</strong> entwickeln verschiedenfarbige Blüten. Dazwischen senden<br />
Sterne ihre Strahlen aus. Die beidseitig neben der Kanzel gemalten Jahreszahlen<br />
verweisen auf den Aufbau des Schiffes 1699 <strong>und</strong> die Neugestaltung des Raumes ab<br />
1921. Die dekorativen Pflanzenmotive kehren reduziert an den Seitenwangen der Bänke<br />
im Kirchenschiff wieder. Zum Gelb der Wände, den Grün - <strong>und</strong> Orangetönen am Altar,<br />
718 MÜLLER 1924, H. 11/12, T. 2, S. 92.<br />
719 Auf die ‚Aktualisierung’ der Bergpredigt in der Zeit der Weimarer Republik verweist PETERS<br />
1996, S. 222-225 anhand von Werken Peter Heckers <strong>und</strong> Wilhelm Remmes im Rheinland.<br />
720 Ein in der Kirche befindliches Foto zeigt den Vorzustand des Raumes.