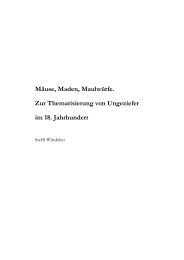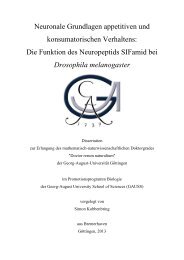Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion<br />
und organisatorisch in der Lage waren an einer 15-wöchigen Behandlung teilzunehmen.<br />
Wegen der geringen zur Verfügung stehenden Versuchspersonenzahl konnten bekannte<br />
potentielle Störfaktoren durch Eliminierung oder Konstanthaltung nicht in vollem Umfang<br />
kontrolliert werden. Alle Familien, bei denen die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt waren,<br />
wurden in die Studie aufgenommen, was zu nicht-äquivalenten Gruppen geführt hat. Sowohl<br />
das Intelligenzniveau als auch die gleichzeitige Behandlung mit Psychostimulanzien waren in<br />
den Gruppen ungleichverteilt. Die Kinder der THOP-Gruppe sowie die der Gruppe, welche<br />
das kombinierte Training nach Lauth und Schlottke erhielt, waren im Schnitt acht bzw. sechs<br />
IQ-Punkte intelligenter als die Kinder der Wartegruppe und jene, die nur das Basistraining<br />
nach Lauth und Schlottke erhalten haben. Die letztgenannten Kinder waren etwas älter. Ein<br />
entscheidender Faktor entstand durch die gleichzeitige Behandlung mit Psychostimulanzien.<br />
In der LS10-Gruppe und in der Wartegruppe erhielten 6% Psychostimulanzien, in der LS15-<br />
Gruppe 20% und in der THOP-Gruppe sogar 48%. Durch Kontrolle dieses Faktors konnte<br />
belegt werden, dass Kinder, die gleichzeitig zum Trainingszeitraum medikamentös behandelt<br />
wurden, größere Veränderungen in externalisierenden, hyperaktiven und impulsiven<br />
Verhaltensweisen zeigten, als Kinder ohne Psychostimulanzientherapie. Dieses Ergebnis<br />
spricht für eine Kombination von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen mit<br />
Psychostimulanzien. Erst durch die Medikamenteneffekte scheinen manche Kinder von<br />
therapeutischen Maßnahmen profitieren zu können.<br />
In Studie 4 kam trotz Randomisierung bzgl. Intelligenz und gleichzeitiger Behandlung<br />
mit Psychostimulanzien eine vergleichbare Konstellation wie in den Studien 1-3 zustande.<br />
Die mit dem Marburger Konzentrationstraining behandelten Kinder waren intelligenter als die<br />
Kinder der Kontrollgruppe (ca. neun IQ-Punkte) und wurden häufiger medikamentös<br />
behandelt (60% vs. 13%). Der Effekt der Medikamente ist in dieser Studie jedoch nicht<br />
eindeutig zu interpretieren.<br />
Ein weiterer Aspekt für die relativ geringe Wirksamkeit der Trainingsprogramme<br />
könnte darin begründet sein, dass die Nachtestung in den einzelnen Studien dieser Arbeit<br />
relativ früh erfolgte. Verzögerte Auswirkungen der Therapie zeigen sich aufgrund<br />
notwendiger Umstrukturierungsprozesse manchmal erst nach einigen Monaten. Dies ist ein so<br />
genannter „sleeper effect“ (Bell, Lynne & Kolvin, 1989).<br />
181