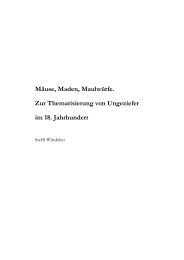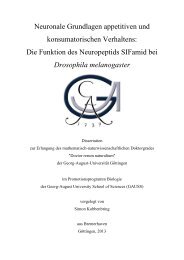Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Eigene Fragestellung<br />
bearbeitet werden, sondern nur solche, die für die Familie relevant sind. Dem Programm soll<br />
eine umfassende Diagnostik vorgeschaltet sein. Anhand der Ergebnisse der Diagnostik wird<br />
dann gemeinsam mit den Eltern eine Problemdefinition vorgenommen. Es werden<br />
insbesondere Prinzipien umgesetzt, die die Bedingungen verändern, die das Problem<br />
(besonders externale Auffälligkeiten) innerhalb der Familie aufrechterhalten.<br />
Es werden folgende Grundprinzipien formuliert:<br />
• Konsequenzen müssen unmittelbar auf das Verhalten folgen,<br />
• Verbale Konsequenzen (Lob und Tadel) müssen spezifisch sein,<br />
• Konsequenzen müssen konsistent erfolgen,<br />
• Zuerst werden Belohnungs-, danach erst Bestrafungsmethoden vermittelt,<br />
• Reaktionen auf mögliches Fehlverhalten sollten in jeder Situation bedacht werden.<br />
Ausgehend von Belastungsfaktoren auf der Makroebene der Familie (z.B. Eigenschaften,<br />
Wünsche, Ziele und Belastungen der Eltern und des Kindes) wird eine Verbindung auf der<br />
Mikroebene hergestellt. Ziele des Programms ist es auf der Mikroebene die alltäglichen<br />
Belastungen der Eltern-Kind-Interaktion zu verändern. Dabei ist die Intervention auf der<br />
Mikroebene in eine Intervention bzgl. des familiären und psychosozialen Bedingungsgefüges<br />
(Makroebene) eingebettet. Positive Veränderungen auf der Mikroebene können nur dann<br />
stabil sein, wenn auf der Makroebene keine grundlegenden Faktoren den Erfolg der<br />
Maßnahmen behindern. Da Mikro- und Makroebene zirkulär miteinander verknüpft sind,<br />
muss die wechselseitige Beeinflussung dieser Ebenen beachtet werden.<br />
Die äußere Struktur des Eltern-Kind-Programms ist wie folgt gegliedert:<br />
1. Problemdefinition, Entwicklung eines Störungskonzeptes und Behandlungsplanung<br />
(Erwerb von Kenntnissen über das Störungsbild und mögliche Ursachen der<br />
Entstehung und Aufrechterhaltung).<br />
2. Förderung positiver Eltern-Kind-Interaktionen und Eltern-Kind-Beziehungen<br />
(Unterbrechung dysfunktionaler Interaktionsmuster durch die Wahrnehmung positiver<br />
Eigenschaften des Kindes und positiver Reaktionen hierauf durch die Eltern).<br />
3. Pädagogisch-therapeutische Interventionen zur Verminderung impulsivem und<br />
oppositionellem Verhalten (Erwerb und Einsatz pädagogisch-therapeutischer<br />
Interventionen bzw. spezifischer operanter Methoden durch die Eltern).<br />
4. Spezielle operante Methoden (Vermittlung von Token- und response-cost-Systemen).<br />
63