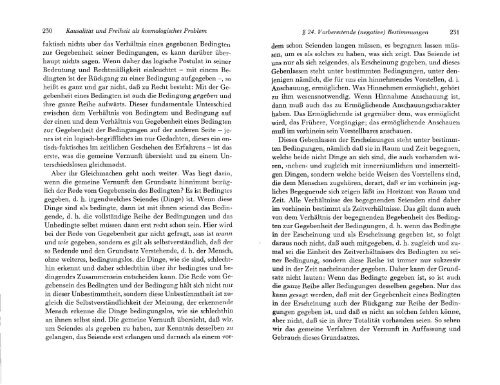Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
230 Kausalität und <strong>Freiheit</strong> als kosmologisches Problem<br />
faktisch nichts uber das Verhältnis eines gegebenen Bedingten<br />
zur Gegebenheit seiner Bedingungen, es kann darüber überhaupt<br />
nichts sagen. Wenn daher das logische Postulat in seiner<br />
Bedeutung und Rechtmäßigkeit einleuchtet - mit einem Bedingten<br />
ist <strong>der</strong> Rückgang zu einer Bedingung aufgegeben -, so<br />
heißt es ganz und gar nicht, daß zu Recht besteht: Mit <strong>der</strong> Gegebenheit<br />
eines Bedingten ist auch die Bedingung gegeben und<br />
ihre ganze Reihe aufwärts. Dieser fundamentale Unterschied<br />
zwischen dem Verhältnis von Bedingtem und Bedingung auf<br />
<strong>der</strong> einen und dem Verhältnis von Gegebenheit eines Bedingten<br />
zur Gegebenheit <strong>der</strong> Bedingungen auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite - jenes<br />
ist ein logisch-begriffliches im nur Gedachten, dieses ein ontisch-faktisches<br />
im zeitlichen Geschehen des Erfahrens - ist das<br />
erste, was die gemeine Vernunft übersieht und zu einem Unterschiedslosen<br />
gleichmacht.<br />
Aber ihr Gleichmachen geht noch weiter. Was liegt darin,<br />
wenn die gemeine Vernunft den Grundsatz hinnimmt bezüglich<br />
<strong>der</strong> Rede vom Gegebensein des Bedingten? Es ist Bedingtes<br />
gegeben, d. h. irgendwelches Seiendes (Dinge) ist. Wenn diese<br />
Dinge sind als bedingte, dann ist mit ihnen seiend das Bedingende,<br />
d. h. die vollständige Reihe <strong>der</strong> Bedingungen und das<br />
Unbedingte selbst mussen dann erst recht schon sein. Hier wird<br />
bei <strong>der</strong> Rede von Gegebenheit gar nicht gefragt, was ist wann<br />
und wie gegeben, son<strong>der</strong>n es gilt als selbstverständlich, daß <strong>der</strong><br />
so Redende und den Grundsatz Verstehende, d. h. <strong>der</strong> Mensch,<br />
ohne weiteres, bedingungslos, die Dinge, wie sie sind, schlechthin<br />
erkennt und daher schlechthin über ihr bedingtes und bedingendes<br />
Zusammensein entscheiden kann. Die Rede vom Gegebensein<br />
des Bedingten und <strong>der</strong> Bedingung hält sich nicht nur<br />
in dieser Unbestimmtheit, son<strong>der</strong>n diese Unbestimmtheit ist zugleich<br />
die Selbstverständlichkeit <strong>der</strong> Meinung, <strong>der</strong> erkennende<br />
Mensch erkenne die Dinge bedingungslos, wie sie schlechthin<br />
an ihnen selbst sind. Die gemeine Vernunft übersieht, daß wir,<br />
um Seiendes als gegeben zu haben, zur Kenntnis desselben zu<br />
gelangen, das Seiende erst erlangen und darnach als einem vor-<br />
§ 24. Vorberntende (negative) Bestimmungen 231<br />
dem schon Seienden langen müssen, es begegnen lassen müssen,<br />
um es als solches zu haben, was sich zeigt. Das Seiende ist<br />
uns nur als sich zeigendes, als Erscheinung gegeben, und dieses<br />
Gebenlassen steht unter bestimmten Bedingungen, unter denjenigen<br />
nämlich, die für uns ein hinnehmendes Vorstellen, d. i.<br />
Anschauung, ermöglichen. Was Hinnehmen ermöglicht, gehört<br />
zu ihm wesensnotwendig. Wenn Hinnahme Anschauung ist,<br />
dann muß auch das zu Ermöglichende Anschauungscharakter<br />
haben. Das Ermöglichende ist gegenüber dem, was ermöglicht<br />
wird, das Frühere, Vorgängige; das ermöglichende Anschauen<br />
muß im vorhinein sein Vorstellbares anschauen.<br />
Dieses Gebenlassen <strong>der</strong> Erscheinungen steht unter bestimmten<br />
Bedingungen, nämlich daß sie in Raum und Zeit begegnen,<br />
welche beide nicht Dinge an sich sind, die auch vorhanden wären,<br />
>neben< und zugleich mit innerräumlichen und innerzeitigen<br />
Dingen, son<strong>der</strong>n welche beide Weisen des Vorstellens sind,<br />
die dem Menschen zugehören, <strong>der</strong>art, daB er im vorhinein jegliches<br />
Begegnende sich zeigen läßt im Horizont von Raum und<br />
Zeit. Alle Verhältnisse des begegnenden Seienden sind daher<br />
im vorhinein bestimmt als Zeitverhältnisse. Das gilt dann auch<br />
von dem Verhältnis <strong>der</strong> begegnenden Begebenheit des Bedingten<br />
zur Gegebenheit <strong>der</strong> Bedingungen, d. h. wenn das Bedingte<br />
in <strong>der</strong> Erscheinung und als Erscheinung gegeben ist, so folgt<br />
daraus noch nicht, daß auch mitgegeben, d. h. zugleich und zumal<br />
sei die Einheit des Zeitverhältnisses des Bedingten zu seiner<br />
Bedingung, son<strong>der</strong>n diese Reihe ist immer nur sukzessiv<br />
und in <strong>der</strong> Zeit nacheinan<strong>der</strong> gegeben. Daher kann <strong>der</strong> Grundsatz<br />
nicht lauten: Wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch<br />
die ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben. Nur das<br />
kann gesagt werden, daß mit <strong>der</strong> Gegebenheit eines Bedingten<br />
in <strong>der</strong> Erscheinung auch <strong>der</strong> Rückgang zur Reihe <strong>der</strong> Bedingungen<br />
gegeben ist, und daß es nicht an solchen fehlen könne,<br />
aber nicht, daß sie in ihrer Totalität vorhanden seien. So sehen<br />
wir das gemeine Verfahren <strong>der</strong> Vernunft in Auffassung und<br />
Gebrauch dieses Grundsatzes.