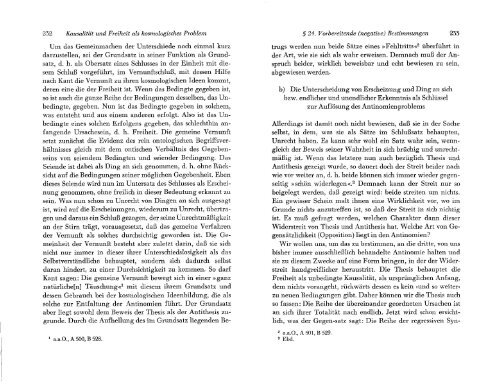Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
232 Kausalität und <strong>Freiheit</strong> als kosmologisches Problem<br />
Um das Gemeinrnachen <strong>der</strong> Unterschiede noch einmal kurz<br />
darzustellen, sei <strong>der</strong> Grundsatz in seiner Funktion als Grundsatz,<br />
d. h. als Obersatz eines Schlusses in <strong>der</strong> Einheit mit diesem<br />
Schluß vorgeführt, im Vernunfts chluß , mit dessen Hilfe<br />
nach Kant die Vernunft zu ihren kosmologischen Ideen kommt,<br />
<strong>der</strong>en eine die <strong>der</strong> <strong>Freiheit</strong> ist. Wenn das Bedingte gegeben ist,<br />
so ist auch die ganze Reihe <strong>der</strong> Bedingungen desselben, das Unbedingte,<br />
gegeben. Nun ist das Bedingte gegeben in solchem,<br />
was entsteht und aus einem an<strong>der</strong>en erfolgt. Also ist das Unbedingte<br />
eines solchen Erfolgens gegeben, das schlechthin anfangende<br />
Ursachesein, d. h. <strong>Freiheit</strong>. Die gemeine Vernunft<br />
setzt zunächst die Evidenz des rein ontologischen Begriffsverhältnisses<br />
gleich mit dem ontischen Verhältnis des Gegebenseins<br />
von seiendem Bedingten und seien<strong>der</strong> Bedingung. Das<br />
Seiende ist dabei als Ding an sich genommen, d. h. ohne Rücksicht<br />
auf die Bedingungen seiner möglichen Gegebenheit. Eben<br />
dieses Seiende wird nun im Untersatz des Schlusses als Erscheinung<br />
genommen, ohne freilich in dieser Bedeutung erkannt zu<br />
sein. Was nun schon zu Unrecht von Dingen an sich ausgesagt<br />
ist, wird auf die Erscheinungen, wie<strong>der</strong>um zu Unrecht, übertragen<br />
und daraus ein Schluß gezogen, <strong>der</strong> seine Unrechtmäßigkeit<br />
an <strong>der</strong> Stirn trägt, vorausgesetzt, daß das gemeine Verfahren<br />
<strong>der</strong> Vernunft als solches durchsichtig geworden ist. Die Gemeinheit<br />
<strong>der</strong> Vernunft besteht aber zuletzt darin, daß sie sich<br />
nicht nur immer in dieser ihrer Unterschiedslosigkeit als das<br />
Selbstverständliche behauptet, son<strong>der</strong>n sich dadurch selbst<br />
daran hin<strong>der</strong>t, zu einer Durchsichtigkeit zu kommen. So darf<br />
Kant sagen: Die gemeine Vernunft bewegt sich in einer »ganz<br />
natürliche[n] Täuschung«1 mit diesem ihrem Grundsatz und<br />
dessen Gebrauch bei <strong>der</strong> kosmologischen Ideenbildung, die als<br />
solche zur Entfaltung <strong>der</strong> Antinomien führt. Der Grundsatz<br />
aber liegt sowohl dem Beweis <strong>der</strong> Thesis als <strong>der</strong> Antithesis zugrunde.<br />
Durch die Aufhellung des im Grundsatz liegenden Be-<br />
1 a.a.O., A 500, B 528.<br />
§ 24. Vorbereitende (negative) Bestimmungen 233<br />
trugs werden nun beide Sätze eines »Fehltritts«2 überführt in<br />
<strong>der</strong> Art, wie sie sich als wahr erweisen. Demnach muß <strong>der</strong> Anspruch<br />
bei<strong>der</strong>, wirklich beweisbar und echt bewiesen zu sein,<br />
abgewiesen werden.<br />
b) Die Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich<br />
bzw. endlicher und unendlicher Erkenntnis als Schlüssel<br />
zur Auflösung des Antinomienproblems<br />
Allerdings ist damit noch nicht bewiesen, daß sie in <strong>der</strong> Sache<br />
selbst, in dem, was sie als Sätze im Schlußsatz behaupten,<br />
Unrecht haben. Es kann sehr wohl ein Satz wahr sein, wenngleich<br />
<strong>der</strong> Beweis seiner Wahrheit in sich brüchig und unrechtmäßig<br />
ist. Wenn das letztere nun auch bezüglich Thesis und<br />
Antithesis gezeigt wurde, so dauert doch <strong>der</strong> Streit bei<strong>der</strong> nach<br />
wie vor weiter an, d. h. beide können sich immer wie<strong>der</strong> gegenseitig<br />
»schön wi<strong>der</strong>legen«.3 Demnach kann <strong>der</strong> Streit nur so<br />
beigelegt werden, daß gezeigt wird: beide streiten um nichts.<br />
Ein gewisser Schein malt ihnen eine Wirklichkeit vor, wo im<br />
Grunde nichts anzutreffen ist, so daß <strong>der</strong> Streit in sich nichtig<br />
ist. Es muß gefragt werden, welchen Charakter dann dieser<br />
Wi<strong>der</strong>streit von Thesis und Antithesis hat. '''elche Art von Gegensätzlichkeit<br />
(Opposition) liegt in den Antinomien?<br />
Wir wollen uns, um das zu bestimmen, an die dritte, von uns<br />
bisher immer ausschließlich behandelte Antinomie halten und<br />
sie zu diesem Zwecke auf eine Form bringen, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>streit<br />
handgreiflicher heraustritt. Die Thesis behauptet die<br />
<strong>Freiheit</strong> als unbedingte Kausalität, als ursprünglichen Anfang,<br />
dem nichts vorangeht, rückwärts dessen es kein >und so weiter<<br />
zu neuen Bedingungen gibt. Daher können wir die Thesis auch<br />
so fassen: Die Reihe <strong>der</strong> übereinan<strong>der</strong> geordneten Ursachen ist<br />
an sich ihrer Totalität nach endlich. Jetzt wird schon ersichtlich,<br />
was <strong>der</strong> Gegen-satz sagt: Die Reihe <strong>der</strong> regressiven Syn-<br />
2 a.a.O., A 501, B 529.<br />
3 Ebd.