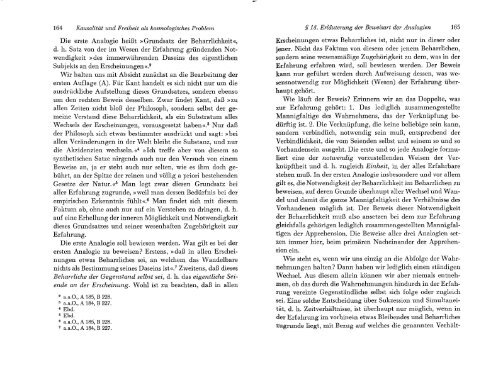Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
164 Kausalität und <strong>Freiheit</strong> als kosmologisches Problem<br />
Die erste Analogie heißt »Grundsatz <strong>der</strong> Beharrlichkeit«,<br />
d. h. Satz von <strong>der</strong> im <strong>Wesen</strong> <strong>der</strong> Erfahrung gründenden Notwendigkeit<br />
»des immerwährenden Daseins des eigentlichen<br />
Subjekts an den Erscheinungen «.2<br />
Wir halten uns mit Absicht zunächst an die Bearbeitung <strong>der</strong><br />
ersten Auflage (A). Für Kant handelt es sich nicht nur um die<br />
ausdrückliche Aufstellung dieses Grundsatzes, son<strong>der</strong>n ebenso<br />
um den rechten Beweis desselben. Zwar findet Kant, daß »zu<br />
allen Zeiten nicht bloß <strong>der</strong> Philosoph, son<strong>der</strong>n selbst <strong>der</strong> gemeine<br />
Verstand diese Beharrlichkeit, als ein Substratum alles<br />
Wechsels <strong>der</strong> Erscheinungen, vorausgesetzt haben«.3 Nur daß<br />
<strong>der</strong> Philosoph sich etwas bestimmter ausdrückt und sagt: »bei<br />
allen Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Welt bleibt die Substanz, und nur<br />
die Akzidenzien wechseln.«4 »Ich treffe aber von diesem so<br />
synthetischen Satze nirgends auch nur den Versuch von einem<br />
Beweise an, ja er steht auch nur selten, wie es ihm doch gebührt,<br />
an <strong>der</strong> Spitze <strong>der</strong> reinen und völlig apriori bestehenden<br />
Gesetze <strong>der</strong> Natur.«5 Man legt zwar diesen Grundsatz bei<br />
aller Erfahrung zugrunde, »weil man dessen Bedürfnis bei <strong>der</strong><br />
empirischen Erkenntnis fühlt«.6 Man findet sich mit diesem<br />
Faktum ab, ohne auch nur auf ein Verstehen zu dringen, d. h.<br />
auf eine Erhellung <strong>der</strong> inneren Möglichkeit und Notwendigkeit<br />
dieses Grundsatzes und seiner wesenhaften Zugehörigkeit zur<br />
Erfahrung.<br />
Die erste Analogie soll bewiesen werden. Was gilt es bei <strong>der</strong><br />
ersten Analogie zu beweisen? Erstens, »daß in allen Erscheinungen<br />
etwas Beharrliches sei, an welchem das Wandelbare<br />
nichts als Bestimmung seines Daseins ist«.7 Zweitens, daß dieses<br />
Beharrliche <strong>der</strong> Gegenstand selbst sei, d. h. das eigentliche Seiende<br />
an <strong>der</strong> Erscheinung. Wohl ist zu beachten, daß in allen<br />
2 a.a.O., A 185, B 228.<br />
3 a.a.O., A 184, B 227.<br />
4 Ebd.<br />
5 Ebd.<br />
6 a.a.O., A 185, B 228.<br />
7 a.a.O., A 184, B 227.<br />
§ 18. Erläuterung <strong>der</strong> Beweisart <strong>der</strong> Analogien 165<br />
Erscheinungen etwas Beharrliches ist, nicht nur in dieser o<strong>der</strong><br />
jener. Nicht das Faktum von diesem o<strong>der</strong> jenem Beharrlichen,<br />
son<strong>der</strong>n seine wesensmäßige Zugehörigkeit zu dem, was in <strong>der</strong><br />
Erfahrung erfahren wird, soll bewiesen werden. Der Beweis<br />
kann nur geführt werden durch Aufweisung dessen, was wesensnotwendig<br />
zur Möglichkeit (<strong>Wesen</strong>) <strong>der</strong> Erfahrung überhaupt<br />
gehört.<br />
Wie läuft <strong>der</strong> Beweis? Erinnern wir an das Doppelte, was<br />
zur Erfahrung gehört: 1. Das lediglich zusammengestellte<br />
Mannigfaltige des Wahrnehmens, das <strong>der</strong> Verknüpfung bedürftig<br />
ist. 2. Die Verknüpfung, die keine beliebige sein kann,<br />
son<strong>der</strong>n verbindlich, notwendig sein muß, entsprechend <strong>der</strong><br />
Verbindlichkeit, die vom Seienden selbst und seinem so und so<br />
Vorhandensein ausgeht. Die erste und so jede Analogie formuliert<br />
eine <strong>der</strong> notwendig vorzustellenden Weisen <strong>der</strong> Verknüpftheit<br />
und d. h. zugleich Einheit, in <strong>der</strong> alles Erfahrbare<br />
stehen muß. In <strong>der</strong> ersten Analogie insbeson<strong>der</strong>e und vor allem<br />
gilt es, die Notwendigkeit <strong>der</strong> Beharrlichkeit im Beharrlichen zu<br />
beweisen, auf <strong>der</strong>en Grunde überhaupt aller Wechsel und Wandel<br />
und damit die ganze Mannigfaltigkeit <strong>der</strong> Verhältnisse des<br />
Vorhandenen möglich ist. Der Beweis dieser Notwendigkeit<br />
<strong>der</strong> Beharrlichkeit muß also ansetzen bei dem zur Erfahrung<br />
gleichfalls gehörigen lediglich zusammengestellten Mannigfaltigen<br />
<strong>der</strong> Apprehension. Die Beweise aller drei Analogien setzen<br />
immer hier, beim primären Nacheinan<strong>der</strong> <strong>der</strong> Apprehension<br />
ein.<br />
Wie steht es, wenn wir uns einzig an die Abfolge <strong>der</strong> Wahrnehmungen<br />
halten? Dann haben wir lediglich einen ständigen<br />
Wechsel. Aus diesem allein können wir aber niemals entnehmen,<br />
ob das durch die Wahrnehmungen hindurch in <strong>der</strong> Erfahrung<br />
vereinte Gegenständliche selbst sich folge o<strong>der</strong> zugleich<br />
sei. Eine solche Entscheidung über Sukzession und Simultaneität,<br />
d. h. Zeitverhältnisse, ist überhaupt nur möglich, wenn in<br />
<strong>der</strong> Erfahrung im vorhinein etwas Bleibendes und Beharrliches<br />
zugrunde liegt, mit Bezug auf welches die genannten Verhält-