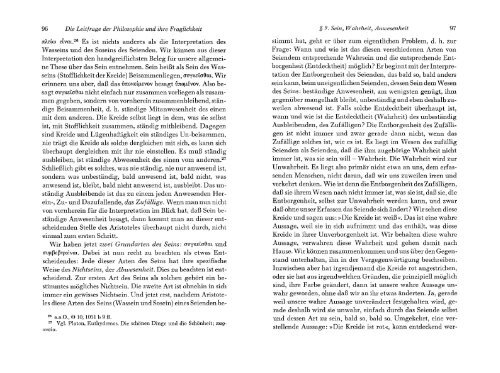Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
96 Die Leitfrage <strong>der</strong> Philosophie und ihre Fraglichkeit<br />
JtAELW dvm. 26 Es ist nichts an<strong>der</strong>es als die Interpretation des<br />
Wasseins und des Soseins des Seienden. Wir können aus dieser<br />
Interpretation den handgreiflichsten Beleg für unsere allgemeine<br />
These über das Sein entnehmen. Sein heißt als Sein des Wasseins<br />
(Stofflichkeit <strong>der</strong> Kreide) Beisammenliegen, auyxELa{tm. Wir<br />
erinnern uns aber, daß das UJtOXEL[tEVOV besagt UJtO[tEVOV. Also besagt<br />
auyxELa{tm nicht einfach nur zusammen vorliegen als zusammen<br />
gegeben, son<strong>der</strong>n von vornherein zusammenbleibend, ständige<br />
Beisammenheit, d. h. ständige Mitanwesenheit des einen<br />
mit dem an<strong>der</strong>en. Die Kreide selbst liegt in dem, was sie selbst<br />
ist, mit Stofflichkeit zusammen, ständig mitbleibend. Dagegen<br />
sind Kreide und Lügenhaftigkeit ein ständiges Un-beisammen,<br />
nie trägt die Kreide als solche <strong>der</strong>gleichen mit sich, es kann sich<br />
überhaupt <strong>der</strong>gleichen mit ihr nie einstellen. Es muß ständig<br />
ausbleiben, ist ständige Abwesenheit des einen vom an<strong>der</strong>en. 27<br />
Schließlich gibt es solches, was nie ständig, nie nur anwesend ist,<br />
son<strong>der</strong>n was unbeständig, bald anwesend ist, bald nicht, was<br />
anwesend ist, bleibt, bald nicht anwesend ist, ausbleibt. Das unständig<br />
Ausbleibende ist das zu einem jeden Anwesenden Herein-,<br />
Zu- und Dazufallende, das Zufällige. Wenn man nun nicht<br />
von vornherein für die Interpretation im Blick hat, daß Sein beständige<br />
Anwesenheit besagt, dann kommt man an dieser entscheidenden<br />
Stelle des Aristoteles überhaupt nicht durch, nicht<br />
einmal zum ersten Schritt.<br />
Wir haben jetzt zwei Grundarten des Seins: OUyxELo{tm und<br />
oU[tßEßrptEvm. Dabei ist nun recht zu beachten als etwas Entscheidendes:<br />
Jede dieser Arten des Seins hat ihre spezifische<br />
Weise des Nichtseins, <strong>der</strong> Abwesenheit. Dies zu beachten ist entscheidend.<br />
Zur ersten Art des Seins als solchen gehört ein bestimmtes<br />
mögliches Nichtsein. Die zweite Art ist ohnehin in sich<br />
immer ein gewisses Nichtsein. Und jetzt erst, nachdem Aristoteles<br />
diese Arten des Seins (Wassein und Sosein) eines Seienden be-<br />
26 a.a.O., e 10, 1051 b 9 ff.<br />
27 Vgl. Platon, Euthydemos. Die schönen Dinge und die Schönheit; 1tUeouaLu<br />
..<br />
§ 9. Sein, Wahrheit, Anwesenheit 97<br />
stimmt hat, geht er über zum eigentlichen Problem, d. h. zur<br />
Frage: Wann und wie ist das diesen verschiedenen Arten von<br />
Seiendem entsprechende Wahrsein und die entsprechende Entborgenheit<br />
(Entdecktheit) möglich? Er beginnt mit <strong>der</strong> Interpretation<br />
<strong>der</strong> Entborgenheit des Seienden, das bald so, bald an<strong>der</strong>s<br />
sein kann, beim uneigentlichen Seienden, dessen Sein dem <strong>Wesen</strong><br />
des Seins: beständige Anwesenheit, am wenigsten genügt, ihm<br />
gegenüber mangelhaft bleibt, unbeständig und eben deshalb zuweilen<br />
abwesend ist. Falls solche Entdecktheit überhaupt ist,<br />
wann und wie ist die Entdecktheit (Wahrheit) des unbeständig<br />
Ausbleibenden, des Zufälligen? Die Entborgenheit des Zufälligen<br />
ist nicht immer und zwar gerade dann nicht, wenn das<br />
Zufällige solches ist, wie es ist. Es liegt im <strong>Wesen</strong> des zufällig<br />
Seienden als Seienden, daß die ihm zugebörige Wahrheit nicht<br />
immer ist, was sie sein will- Wahrheit. Die Wahrheit wird zur<br />
Unwahrheit. Es liegt also primär nicht etwa an uns, dem erfassenden<br />
Menschen, nicht daran, daß wir uns zuweilen irren und<br />
verkehrt denken. Wie ist denn die Entborgenheit des Zufälligen,<br />
daß sie ihrem <strong>Wesen</strong> nach nicht immer ist, was sie ist, daß sie, die<br />
Entborgenheit, selbst zur Unwahrheit werden kann, und zwar<br />
daß ohne unser Erfassen das Seiende sich än<strong>der</strong>t? Wir sehen diese<br />
Kreide und sagen aus: »Die Kreide ist weiß«. Das ist eine wahre<br />
Aussage, weil sie in sich aufnimmt und das enthält, was diese<br />
Kreide in ihrer Unverborgenheit ist. Wir behalten diese wahre<br />
Aussage, verwahren diese Wahrheit und gehen damit nach<br />
Hause. Wir können zusammenkommen und uns über den Gegenstand<br />
unterhalten, ihn in <strong>der</strong> Vergegenwärtigung beschreiben.<br />
Inzwischen aber hat irgendjemand die Kreide rot angestrichen,<br />
o<strong>der</strong> sie hat aus irgendwelchen Gründen, die prinzipiell möglich<br />
sind, ihre Farbe geän<strong>der</strong>t, dann ist unsere wahre Aussage unwahr<br />
geworden, ohne daß wir an ihr etwas än<strong>der</strong>ten. Ja, gerade<br />
weil unsere wahre Aussage unverän<strong>der</strong>t festgehalten wird, gerade<br />
deshalb wird sie unwahr, einfach durch das Seiende selbst<br />
und dessen Art zu sein, bald so, bald so. Umgekehrt, eine verstellende<br />
Aussage: »Die Kreide ist rot«, kann entdeckend wer-