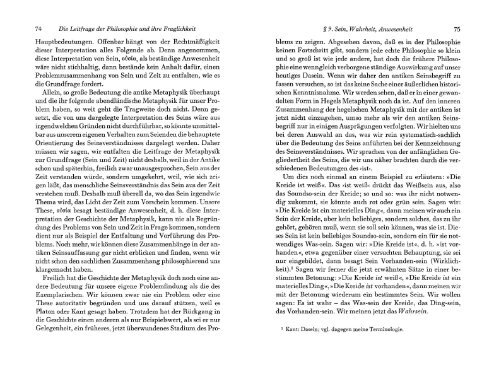Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
74 Die Leitfrage <strong>der</strong> Philosophie und ihre Fraglichkeit<br />
Hauptbedeutungen. Offenbar hängt von <strong>der</strong> Rechtmäßigkeit<br />
dieser Interpretation alles Folgende ab. Denn angenommen,<br />
diese Interpretation von Sein, ovuLa, als beständige Anwesenheit<br />
wäre nicht stichhaltig, dann bestände kein Anhalt dafür, einen<br />
Problemzusammenhang von Sein und Zeit zu entfalten, wie es<br />
die Grundfrage for<strong>der</strong>t.<br />
Allein, so große Bedeutung die antike Metaphysik überhaupt<br />
und die ihr folgende abendländische Metaphysik für unser Problem<br />
haben, so weit geht die Tragweite doch nicht. Denn gesetzt,<br />
die von uns dargelegte Interpretation des Seins wäre aus<br />
irgendwelchen Gründen nicht durchführbar, so könnte unmittelbar<br />
aus unserem eigenen Verhalten zum Seienden die behauptete<br />
Orientierung des Seinsverständnisses dargelegt werden. Daher<br />
müssen wir sagen, wir entfalten die Leitfrage <strong>der</strong> Metaphysik<br />
zur Grundfrage (Sein und Zeit) nicht deshalb, weil in <strong>der</strong> Antike<br />
schon und späterhin, freilich zwar unausgesprochen, Sein aus <strong>der</strong><br />
Zeit verstanden würde, son<strong>der</strong>n umgekehrt, weil, wie sich zeigen<br />
läßt, das menschliche Seinsverständnis das Sein aus <strong>der</strong> Zeit<br />
verstehen muß. Deshalb muß überall da, wo das Sein irgendwie<br />
Thema wird, das Licht <strong>der</strong> Zeit zum Vorschein kommen. Unsere<br />
These, OVULa besagt beständige Anwesenheit, d. h. diese Interpretation<br />
<strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Metaphysik, kann nie als Begründung<br />
des Problems von Sein und Zeit in Frage kommen, son<strong>der</strong>n<br />
dient nur als Beispiel <strong>der</strong> Entfaltung und Vorführung des Problems.<br />
Noch mehr, wir können diese Zusammenhänge in <strong>der</strong> antiken<br />
Seinsauffassung gar nicht erblicken und finden, wenn wir<br />
nicht schon den sachlichen Zusammenhang philosophierend uns<br />
klargemacht haben.<br />
Freilich hat die Geschichte <strong>der</strong> Metaphysik doch noch eine an<strong>der</strong>e<br />
Bedeutung für unsere eigene Problemfindung als die des<br />
Exemplarischen. Wir können zwar nie ein Problem o<strong>der</strong> eine<br />
These autoritativ begründen und uns darauf stützen, weil es<br />
Platon o<strong>der</strong> Kant gesagt haben. Trotzdem hat <strong>der</strong> Rückgang in<br />
die Geschichte einen an<strong>der</strong>en als nur Beispielswert, als sei er nur<br />
Gelegenheit, ein früheres, jetzt überwundenes Stadium des Pro-<br />
§ 9. Sein, Wahrheit, Anwesenheit 75<br />
blems zu zeigen. Abgesehen davon, daß es in <strong>der</strong> Philosophie<br />
keinen Fortschritt gibt, son<strong>der</strong>n jede echte Philosophie so klein<br />
und so groß ist wie jede an<strong>der</strong>e, hat doch die frühere Philosophie<br />
eine wenngleich verborgene ständige Auswirkung auf unser<br />
heutiges Dasein. Wenn wir daher den antiken Seinsbegriff zu<br />
fassen versuchen, so ist das keine Sache einer äußerlichen historischen<br />
Kenntnisnahme. Wir werden sehen, daß er in einer gewandelten<br />
Form in Hegels Metaphysik noch da ist. Auf den inneren<br />
Zusammenhang <strong>der</strong> hegeIschen Metaphysik mit <strong>der</strong> antiken ist<br />
jetzt nicht einzugehen, umso mehr als wir den antiken Seinsbegriff<br />
nur in einigen Ausprägungen verfolgten. Wir hielten uns<br />
bei <strong>der</strong>en Auswahl an das, was wir rein systematisch-sachlich<br />
über die Bedeutung des Seins anführten bei <strong>der</strong> Kennzeichnung<br />
des Seinsverständnisses. Wir sprachen von <strong>der</strong> anfänglichen Geglie<strong>der</strong>theit<br />
des Seins, die wir uns näher brachten durch die verschiedenen<br />
Bedeutungen des >istist weiß< drückt das Weiß sein aus, also<br />
das Soundso-sein <strong>der</strong> Kreide; so und so: was ihr nicht notwendig<br />
zukommt, sie könnte auch rot o<strong>der</strong> grün sein. Sagen wir:<br />
»Die Kreide ist ein materielles Ding«, dann meinen wir auch ein<br />
Sein <strong>der</strong> Kreide, aber kein beliebiges, son<strong>der</strong>n solches, das zu ihr<br />
gehört, gehören muß, wenn sie soll sein können, was sie ist. Dieses<br />
Sein ist kein beliebiges Soundso-sein, son<strong>der</strong>n ein für sie notwendiges<br />
Was-sein. Sagen wir: »Die Kreide ist«, d. h. »ist vorhanden«,<br />
etwa gegenüber einer versuchten Behauptung, sie sei<br />
nur eingebildet, dann besagt Sein Vorhanden-sein (Wirklichkeit).l<br />
Sagen wir ferner die jetzt erwähnten Sätze in einer bestimmten<br />
Betonung: »Die Kreide ist weiß«, »Die Kreide ist ein<br />
ma terielles Ding «, »Die Kreide ist vorhanden «, dann meinen wir<br />
mit <strong>der</strong> Betonung wie<strong>der</strong>um ein bestimmtes Sein. Wir wollen<br />
sagen: Es ist wahr - das Was-sein <strong>der</strong> Kreide, das Ding-sein,<br />
das Vorhanden-sein. Wir meinen jetzt das Wahrsein.<br />
1 Kant: Dasein; vgl. dagegen meine Terminologie.