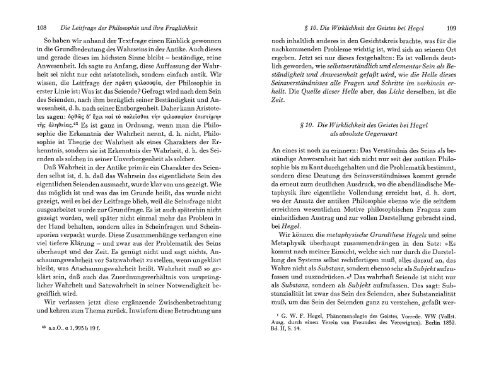Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
108 Die Leitfrage <strong>der</strong> Philosophie und ihre Fraglichkeit<br />
So haben wir anhand <strong>der</strong> Textfrage einen Einblick gewonnen<br />
in die Grundbedeutung des Wahrseins in <strong>der</strong> Antike. Auch dieses<br />
und gerade dieses im höchsten Sinne bleibt - beständige, reine<br />
Anwesenheit. Ich sagte zu Anfang, diese Auffassung <strong>der</strong> Wahrheit<br />
sei nicht nur echt aristotelisch, son<strong>der</strong>n einfach antik. Wir<br />
wissen, die Leitfrage <strong>der</strong> JtQo:J't'Y\ qlLAooocpta, <strong>der</strong> Philosophie in<br />
erster Linie ist: Was ist das Seiende? Gefragt wird nach dem Sein<br />
des Seienden, nach ihm bezüglich seiner Beständigkeit und Anwesenheit,<br />
d. h. nach seiner Entborgenheit. Daher kann Aristoteles<br />
sagen: öQ'fr&~ ö' Ej(EL xat 1:0 xaAELo'frm 1:ljv CPLAooocplav EmOt~!-L'Y\v<br />
tfi~ aA'Y\'frda~.43 Es ist ganz in Ordnung, wenn man die Philosophie<br />
die Erkenntnis <strong>der</strong> Wahrheit nennt, d. h. nicht, Philosophie<br />
ist Theorie <strong>der</strong> Wahrheit als eines Charakters <strong>der</strong> Erkenntnis,<br />
son<strong>der</strong>n sie ist Erkenntnis <strong>der</strong> Wahrheit, d. h. des Seienden<br />
als solchen in seiner Unverborgenheit als solcher.<br />
Daß Wahrheit in <strong>der</strong> Antike primär ein Charakter des Seienden<br />
selbst ist, d. h. daß das Wahrsein das eigentlichste Sein des<br />
eigentlichen Seienden ausmacht, wurde klar von uns gezeigt. Wie<br />
das möglich ist und was das im Grunde heißt, das wurde nicht<br />
gezeigt, weil es bei <strong>der</strong> Leitfrage blieb, weil die Seinsfrage nicht<br />
ausgearbeitet wurde zur Grundfrage. Es ist auch späterhin nicht<br />
gezeigt worden, weil später nicht einmal mehr das Problem in<br />
<strong>der</strong> Hand behalten, son<strong>der</strong>n alles in Scheinfragen und Scheinaporien<br />
verpackt wurde. Diese Zusammenhänge verlangen eine<br />
viel tiefere Klärung - und zwar aus <strong>der</strong> Problematik des Seins<br />
überhaupt und <strong>der</strong> Zeit. Es genügt nicht und sagt nichts, Anschauungswahrheit<br />
vor Satzwahrheit zustellen, wenn ungeklärt<br />
bleibt, was Anschauungswahrheit heißt. Wahrheit muß so geklärt<br />
sein, daß auch das Zuordnungsverhältnis von ursprünglicher<br />
Wahrheit und Satzwahrheit in seiner Notwendigkeit begreiflich<br />
wird.<br />
Wir verlassen jetzt diese ergänzende Zwischenbetrachtung<br />
und kehren zum Thema zurück. Inwiefern diese Betrachtung uns<br />
43 a.a.O., CI. 1, 993 b 19 f.<br />
§ 10. Die Wirklichkeit des Geistes bei Hegel 109<br />
noch inhaltlich an<strong>der</strong>es in den Gesichtskreis brachte, was für die<br />
nachkommenden Probleme wichtig ist, wird sich an seinem Ort<br />
ergeben. Jetzt sei nur dieses festgehalten: Es ist vollends deutlich<br />
geworden, wie selbstverständlich und elementar Sein als Beständigkeit<br />
und Anwesenheit gejaßt wird, wie die Helle dieses<br />
Seinsverständnisses alle Fragen und Schritte im vorhinein erhellt.<br />
Die Quelle dieser Helle aber, das Licht <strong>der</strong>selben, ist die<br />
Zeit.<br />
§ 10. Die Wirklichkeit des Geistes bei H egel<br />
als absolute Gegenwart<br />
An eines ist noch zu erinnern: Das Verständnis des Seins als beständige<br />
Anwesenheit hat sich nicht nur seit <strong>der</strong> antiken Philosophie<br />
bis zu Kant durchgehalten und die Problematik bestimmt,<br />
son<strong>der</strong>n diese Deutung des Seinsverständnisses kommt gerade<br />
da erneut zum deutlichen Ausdruck, wo die abendländische Metaphysik<br />
ihre eigentliche Vollendung erreicht hat, d. h. dort,<br />
wo <strong>der</strong> Ansatz <strong>der</strong> antiken Philosophie ebenso wie die seitdem<br />
erreichten wesentlichen Motive philosophischen Fragens zum<br />
einheitlichen Austrag und zur vollen Darstellung gebracht sind,<br />
bei Hegel.<br />
Wir können die metaphysische Grundthese Hegels und seine<br />
Metaphysik überhaupt zusammendrängen in den Satz: »Es<br />
kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung<br />
des Systems selbst rechtfertigen muß, alles darauf an, das<br />
Wahre nicht als Substanz, son<strong>der</strong>n ebenso sehr als Subjekt aufzufassen<br />
und auszudrücken. «1 Das wahrhaft Seiende ist nicht nur<br />
als Substanz, son<strong>der</strong>n als Subjekt aufzufassen. Das sagt: Substanzialität<br />
ist zwar das Sein des Seienden, aber Substanzialität<br />
muß, um das Sein des Seienden ganz zu yerstehen, gefaßt wer-<br />
1 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Vorrede. WW (Vol1st.<br />
Ausg. durch einen Verein von Freunden des Verewigten). Berlin 1832.<br />
Bd. II, S. 14.