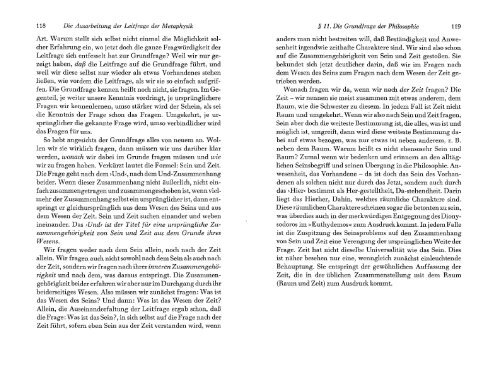Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
118 Die Ausarbeitung <strong>der</strong> Leitfrage <strong>der</strong> Metaphysik<br />
Art. Warum stellt sich selbst nicht einmal die Möglichkeit solcher<br />
Erfahrung ein, wo jetzt doch die ganze Fragwürdigkeit <strong>der</strong><br />
Leitfrage sich entfesselt hat zur Grundfrage? Weil wir nur gezeigt<br />
haben, daß die Leitfrage auf die Grundfrage führt, und<br />
weil wir diese selbst nur wie<strong>der</strong> als etwas Vorhandenes stehen<br />
ließen, wie vordem die Leitfrage, als wir sie so einfach aufgriffen.<br />
Die Grundfrage kennen heißt noch nicht, sie fragen. Im Gegenteil,<br />
je weiter unsere Kenntnis vordringt, je ursprünglichere<br />
Fragen wir kennenlernen, umso stärker wird <strong>der</strong> Schein, als sei<br />
die Kenntnis <strong>der</strong> Frage schon das Fragen. Umgekehrt, je ursprünglicher<br />
die gekannte Frage wird, umso verbindlicher wird<br />
das Fragen für uns.<br />
So hebt angesichts <strong>der</strong> Grundfrage alles von neuem an. Wollen<br />
wir sie wirklich fragen, dann müssen wir uns darüber klar<br />
werden, wonach wir dabei im Grunde fragen müssen und wie<br />
wir zu fragen haben. Verkürzt lautet die Formel: Sein und Zeit.<br />
Die Frage geht nach dem> UndUnd< ist <strong>der</strong> Titel tür eine ursprüngliche Zusammengehörigkeit<br />
von Sein und Zeit aus dem Grunde ihres<br />
<strong>Wesen</strong>s.<br />
Wir fragen we<strong>der</strong> nach dem Sein allein, noch nach <strong>der</strong> Zeit<br />
allein. Wir fragen auch nicht sowohl nach dem Sein als auch nach<br />
<strong>der</strong> Zeit, son<strong>der</strong>n wir fragen nach ihrer inneren Zusammengehörigkeit<br />
und nach dem, was daraus entspringt. Die Zusammengehörigkeit<br />
bei<strong>der</strong> erfahren wir aber nur im Durchgang durch ihr<br />
bei<strong>der</strong>seitiges <strong>Wesen</strong>. Also müssen wir zunächst fragen: Was ist<br />
das <strong>Wesen</strong> des Seins? Und dann: Was ist das <strong>Wesen</strong> <strong>der</strong> Zeit?<br />
Allein, die Auseinan<strong>der</strong>faltung <strong>der</strong> Leitfrage ergab schon, daß<br />
die Frage: Was ist das Sein?, in sich selbst auf die Frage nach <strong>der</strong><br />
Zeit führt, sofern eben Sein aus <strong>der</strong> Zeit verstanden wird, wenn<br />
§ 11. Die Grundfrage <strong>der</strong> Philosophie 119<br />
an<strong>der</strong>s man nicht bestreiten will, daß Beständigkeit und Anwesenheit<br />
irgendwie zeithafte Charaktere sind. Wir sind also schon<br />
auf die Zusammengehörigkeit von Sein und Zeit gestoßen. Sie<br />
bekundet sich jetzt deutlicher darin, daß wir im Fragen nach<br />
dem <strong>Wesen</strong> des Seins zum Fragen nach dem <strong>Wesen</strong> <strong>der</strong> Zeit getrieben<br />
werden.<br />
Wonach fragen wir da, wenn wir nach <strong>der</strong> Zeit fragen? Die<br />
Zeit - wir nennen sie meist zusammen mit etwas an<strong>der</strong>em, dem<br />
Raum, wie die Schwester zu diesem. In jedem Fall ist Zeit nicht<br />
Raum und umgekehrt. Wenn wir also nach Sein und Zeit fragen,<br />
Sein aber doch die weiteste Bestimmung ist, die alles, was ist und<br />
möglich ist, umgreift, dann wird diese weiteste Bestimmung dabei<br />
auf etwas bezogen, was nur etwas ist neben an<strong>der</strong>em, z. B.<br />
neben dem Raum. Warum heißt es nicht ebensosehr Sein und<br />
Raum? Zumal wenn wir bedenken und erinnern an den alltäglichen<br />
Seinsbegriff und seinen übergang in die Philosophie. Anwesenheit,<br />
das Vorhandene - da ist doch das Sein des Vorhandenen<br />
als solchen nicht nur durch das Jetzt, son<strong>der</strong>n auch durch<br />
das >Hier< bestimmt als Her-gestelltheit, Da-stehendheit. Darin<br />
liegt das Hierher, Dahin, welches räumliche Charaktere sind.<br />
Diese räumlichen Charaktere scheinen sogar die betonten zu sein,<br />
was überdies auch in <strong>der</strong> merkwürdigen Entgegnung des Dionysodoros<br />
im »Euthydemos« zum Ausdruck kommt. In jedem Falle<br />
ist die Zuspitzung des Seinsproblems auf den Zusammenhang<br />
von Sein und Zeit eine Verengung <strong>der</strong> ursprünglichen Weite <strong>der</strong><br />
Frage. Zeit hat nicht dieselbe Universalität wie das Sein. Dies<br />
ist näher besehen nur eine, wenngleich zunächst einleuchtende<br />
Behauptung. Sie entspringt <strong>der</strong> gewöhnlichen Auffassung <strong>der</strong><br />
Zeit, die in <strong>der</strong> üblichen Zusammenstellung mit dem Raum<br />
(Raum und Zeit) zum Ausdruck kommt.