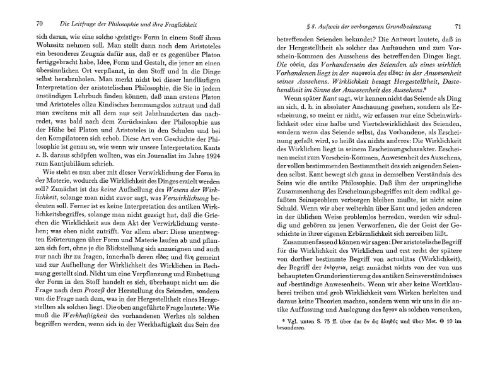Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
70 Die Leitfrage <strong>der</strong> Philosophie und ihre Fraglichkeit<br />
sich daran, wie eine solche >geistige< Form in einem Stoff ihren<br />
Wohnsitz nehmen soll. Man stellt dann noch dem Aristoteles<br />
ein beson<strong>der</strong>es Zeugnis dafür aus, daß er es gegenüber Platon<br />
fertiggebracht habe, Idee, Form und Gestalt, die jener an einen<br />
übersinnlichen Ort verpflanzt, in den Stoff und in die Dinge<br />
selbst herabzuholen. Man merkt nicht bei dieser landläufigen<br />
Interpretation <strong>der</strong> aristotelischen Philosophie, die Sie in jedem<br />
anständigen Lehrbuch finden können, daß man erstens Platon<br />
und Aristoteles allzu Kindisches hemmungslos zutraut und daß<br />
man zweitens mit all dem nur seit Jahrhun<strong>der</strong>ten das nachredet,<br />
was bald nach dem Zurücksinken <strong>der</strong> Philosophie aus<br />
<strong>der</strong> Höhe bei Platon und Aristoteles in den Schulen und bei<br />
den Kompilatoren sich erhob. Diese Art von Geschichte <strong>der</strong> Philosophie<br />
ist genau so, wie wenn wir unsere Interpretation Kants<br />
z. B. daraus schöpfen wollten, was ein Journalist im Jahre 1924<br />
zum Kantjubiläum schrieb.<br />
Wie steht es nun aber mit dieser Verwirklichung <strong>der</strong> Form in<br />
<strong>der</strong> Materie, wodurch die Wirklichkeit des Dinges erzielt werden<br />
soll? Zunächst ist das keine Aufhellung des <strong>Wesen</strong>s <strong>der</strong> Wirklichkeit,<br />
solange man nicht Zuvor sagt, was Verwirklichung bedeuten<br />
soll. Ferner ist es keine Interpretation des antiken Wirklichkeitsbegriffes,<br />
solange man nicht gezeigt hat, daß die Griechen<br />
die Wirklichkeit aus dem Akt <strong>der</strong> Verwirklichung verstehen;<br />
was eben nicht zutrifft. Vor allem aber: Diese unentwegten<br />
Erörterungen über Form und Materie laufen ab und pflanzen<br />
sich fort, ohne je die BlicksteIlung sich anzueignen und auch<br />
nur nach ihr zu fragen, innerhalb <strong>der</strong>en eil'lOI,; und \JA'!'] gemeint<br />
und zur Aufhellung <strong>der</strong> Wirklichkeit des Wirklichen in Rechnung<br />
gestellt sind. Nicht um eine Verpflanzung und Einbettung<br />
<strong>der</strong> Form in den Stoff handelt es sich, überhaupt nicht um die<br />
Frage nach dem Prozeß <strong>der</strong> Herstellung des Seienden, son<strong>der</strong>n<br />
um die Frage nach dem, was in <strong>der</strong> Hergestelltheit eines Hergestellten<br />
als solchen liegt. Die oben angeführte Frage lautete: Wie<br />
muß die Werkhaftigkeit des vorhandenen Werkes als solchen<br />
begriffen werden, wenn sich in <strong>der</strong> Werkhaftigkeit das Sein des<br />
§ 8. Aufweis <strong>der</strong> verborgenen Grundbedeutung 71<br />
betreffenden Seienden bekundet? Die Antwort lautete, daß in<br />
<strong>der</strong> Hergestelltheit als solcher das Auftauchen und zum Vorschein-Kommen<br />
des Aussehens des betreffenden Dinges liegt.<br />
Die ovalu, das Vorhandensein des Seienden als eines wirklich<br />
Vorhandenen liegt in <strong>der</strong> J'tu!]oualu des Eiool,;: in <strong>der</strong> Anwesenheit<br />
seines Aussehens. Wirklichkeit besagt Hergestelltheit, Dastehendheit<br />
im Sinne <strong>der</strong> Anwesenheit des Aussehens. 8<br />
Wenn später Kant sagt, wir kennen nicht das Seiende als Ding<br />
an sich, d. h. in absoluter Anschauung gesehen, son<strong>der</strong>n als Erscheinung,<br />
so meint er nicht, wir erfassen nur eine Scheinwirklichkeit<br />
o<strong>der</strong> eine halbe und Viertelswirklichkeit des Seienden,<br />
son<strong>der</strong>n wenn das Seiende selbst, das Vorhandene, als Erscheinung<br />
gefaßt wird, so heißt das nichts an<strong>der</strong>es: Die Wirklichkeit<br />
des Wirklichen liegt in seinem Erscheinungscharakter. Erscheinen<br />
meint zum Vorschein-Kommen, Anwesenheit des Aussehens,<br />
<strong>der</strong> vollen bestimmenden Bestimmtheit des sich zeigenden Seienden<br />
selbst. Kant bewegt sich ganz in demselben Verständnis des<br />
Seins wie die antike Philosophie. Daß ihm <strong>der</strong> ursprüngliche<br />
Zusammenhang des Erscheinungsbegriffes mit dem radikal gefaßten<br />
Seinsproblem verborgen bleiben mußte, ist nicht seine<br />
Schuld. Wenn wir aber weiterhin über Kant und jeden an<strong>der</strong>en<br />
in <strong>der</strong> üblichen Weise problemlos herreden, werden wir schuldig<br />
und gehören zu jenen Verworfenen, die <strong>der</strong> Geist <strong>der</strong> Geschichte<br />
in ihrer eigenen Erbärmlichkeit sich zerreiben läßt.<br />
Zusammenfassend können wir sagen: Der aristotelische Begriff<br />
für die Wirklichkeit des Wirklichen und erst recht <strong>der</strong> spätere<br />
von dorther bestimmte Begriff von actualitas (Wirklichkeit),<br />
<strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> EVE!]YELU, zeigt zunächst nichts von <strong>der</strong> von uns<br />
behaupteten Grundorientierung des antiken Seinsverständnisses<br />
auf >beständige Anwesenheit