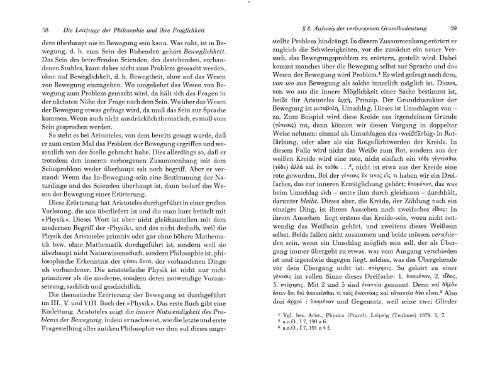Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
58 Die Leitfrage <strong>der</strong> Philosophie und ihre Fraglichkeit<br />
dem überhaupt nie in Bewegung sein kann. Was ruht, ist in Bewegung,<br />
d. h. ZUIll Sein des Ruhenden gehört Beweglichkeit.<br />
Das Sein des betreffenden Seienden, des dastehenden, vorhandenen<br />
Stuhles, kann daher nicht zum Problem gemacht werden,<br />
ohne auf Beweglichkeit, d. h. Bewegtheit, ohne auf das <strong>Wesen</strong><br />
von Bewegung einzugehen. Wo umgekehrt das <strong>Wesen</strong> von Bewegung<br />
zum Problem gemacht wird, da hält sich das Fragen in<br />
<strong>der</strong> nächsten Nähe <strong>der</strong> Frage nach dem Sein. Wo über das VVesen<br />
<strong>der</strong> Bewegung etwas gefragt wird, da muß das Sein zur Sprache<br />
kommen. Wenn auch nicht ausdrücklich thematisch, es muß vom<br />
Sein gesprochen werden.<br />
So steht es bei Aristoteles, von dem bereits gesagt wurde, daß<br />
er zum ersten Mal das Problem <strong>der</strong> Bewegung ergriffen und wesentlich<br />
von <strong>der</strong> Stelle gebracht habe. Dies allerdings so, daß er<br />
trotzdem den inneren verborgenen Zusammenhang mit dem<br />
Seinsproblem we<strong>der</strong> überhaupt sah noch begriff. Aber er verstand:<br />
Wenn das In-Bewegung-sein eine Bestimmung <strong>der</strong> Naturdinge<br />
und des Seienden überhaupt ist, dann bedarf das <strong>Wesen</strong><br />
<strong>der</strong> Bewegung einer Erörterung.<br />
Diese Erörterung hat Aristoteles durchgeführt in einer großen<br />
Vorlesung, die uns überliefert ist und die man kurz betitelt mit<br />
»Physik«. Dieses Wort ist aber nicht gleichzustellen mit dem<br />
modemen Begriff <strong>der</strong> >Physikweißfärbig< in Rotfärbung,<br />
o<strong>der</strong> aber als ein Rotgefärbtwerden <strong>der</strong> Kreide. In<br />
diesem Falle wird nicht das Weiße zum Rot, son<strong>der</strong>n aus <strong>der</strong><br />
weißen Kreide wird eine rote, nicht einfach ein 'tOÖE ytYVEaf}m<br />
('tME) aAAO. xut EX 'tOUÖE ... 2, nicht ist etwa aus <strong>der</strong> Kreide eine<br />
rote geworden. Bei <strong>der</strong> YEVE(Jt~ EX 'ttVO~ Et~ 'tt haben wir ein Dreifaches,<br />
das zur inneren Ermöglichung gehört: VitO/LEVOV, das was<br />
beim Umschlag sich - unter ihm durch gleichsam - durchhält,<br />
darunter bleibt. Dieses aber, die Kreide, <strong>der</strong> Zählung nach ein<br />
einziges Ding, ist ihrem Aussehen nach zweifaches ciöo~: In<br />
ihrem Aussehen liegt erstens das Kreide-sein, wozu nicht notwendig<br />
das Weißsein gehört, und zweitens dieses Weißsein<br />
selbst. Beide fallen nicht zusammen und beide müssen verschieden<br />
sein, wenn ein Umschlag möglich sein soll, <strong>der</strong> als übergang<br />
immer übergeht zu etwas, was vom Ausgang verschieden<br />
ist und irgendwie dagegen liegt, solches, was das Übergehende<br />
VOr dem übergang nicht ist: a'teQ'Y]at~. So gehört zu einer<br />
YEvE(Jt~ im vollen Sinne dieses Dreifache: 1. vrrO~tEVOV, Q. döo~,<br />
3. a'tEQ'Y]at~. Mit Q und 3 sind EVUV'tlU genannt. Denn xat bljAOV<br />
Ea'ttv Ö'tL bei: VitOXELaf}m 'tt 'tOL~ EVUV'tlOt~ xut 'tU.VUV'tlU Mo etvm. 3 Also<br />
drei aQXu[ : vrrO/LEVOv und Gegensatz, weil seine zwei Glie<strong>der</strong><br />
1 Vgl. bes. Arist., Physica (Prantl). Leipzig (Teubner) 1879. I, 7.<br />
2 a.a.O., 1 7,190 a 6.<br />
3 a.a.O., 17, 191 a 4 f.