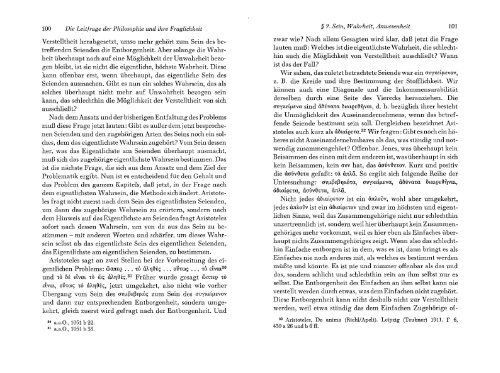Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung ... - gesamtausgabe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
100 Die Leitfrage <strong>der</strong> Philosophie und ihre Fraglichkeit<br />
Verstelltheit herabgesetzt, umso mehr gehört zum Sein des betreffenden<br />
Seienden die Entborgenheit. Aber solange die Wahrheit<br />
überhaupt noch auf eine Möglichkeit <strong>der</strong> Unwahrheit bezogen<br />
bleibt, ist sie nicht die eigentliche, höchste Wahrheit. Diese<br />
kann offenbar erst, wenn überhaupt, das eigentliche Sein des<br />
Seienden ausmachen. Gibt es nun ein solches Wahrsein, das als<br />
solches überhaupt nicht mehr auf Unwahrheit bezogen sein<br />
kann, das schlechthin die Möglichkeit <strong>der</strong> Verstelltheit von sich<br />
ausschließt?<br />
N ach dem Ansatz und <strong>der</strong> bisherigen Entfaltung des Problems<br />
muß diese Frage jetzt lauten: Gibt es außer dem jetzt besprochenen<br />
Seienden und den zugehörigen Arten des Seins noch ein solches,<br />
dem das eigentlichste Wahrsein zugehört? <strong>Vom</strong> Sein dessen<br />
her, was das Eigentlichste am Seienden überhaupt ausmacht,<br />
muß sich das zugehörige eigentlichste Wahrsein bestimmen. Das<br />
ist die nächste Frage, die sich aus dem Ansatz und dem Ziel <strong>der</strong><br />
Problematik ergibt. Nun ist es entscheidend für den Gehalt und<br />
das Problem des ganzen Kapitels, daß jetzt, in <strong>der</strong> Frage nach<br />
dem eigentlichsten Wahrsein, die Methode sich än<strong>der</strong>t. Aristoteles<br />
fragt nicht zuerst nach dem Sein des eigentlichsten Seienden,<br />
um dann das zugehörige Wahrsein zu erörtern, son<strong>der</strong>n nach<br />
dem Hinweis auf das Eigentlichste am Seienden fragt Aristoteles<br />
sofort nach dessen Wahrsein, um von da aus das Sein zu bestimmen<br />
- mit an<strong>der</strong>en Worten und schärfer, um dieses Wahrsein<br />
selbst als das eigentlichste Sein des eigentlichen Seienden,<br />
das Eigentlichste am eigentlichen Seienden, zu bestimmen.<br />
Aristoteles sagt an zwei Stellen bei <strong>der</strong> Vorbereitung des eigentlichen<br />
Problems: WcrJtEQ ..• '"Co UAY]1't/;t; ..• ol),;OOt; ..• '"Co dVUL 30<br />
und '"Co M dVUL '"Co Wt; UA'l'J1'tEt;.31 Früher wurde gesagt wcrJtEQ '"Co<br />
EivUL, ol),;OOt; '"Co UA'l'J1'tEt;, jetzt umgekehrt, also nicht wie vorher<br />
Übergang vom Sein des cruIlßEß'l'JXOt; zum Sein des crUYXELIlEVOV<br />
und dann zur entsprechenden Entborgenheit, son<strong>der</strong>n umgekehrt,<br />
gleich zuerst wird gefragt nach <strong>der</strong> Entborgenheit. Und<br />
30 a.a.O., 1051 b 22.<br />
31 a.a.O., 1051 b 33.<br />
§ 9. Sein, Wahrheit, Anwesenheit 101<br />
zwar wie? Nach allem Gesagten wird klar, daß jetzt die Frage<br />
lauten muß: Welches ist die eigentlichste Wahrheit, die schlechthin<br />
auch die Möglichkeit von Verstelltheit ausschließt? Wann<br />
ist das <strong>der</strong> Fall?<br />
Wir sahen, das zuletzt betrachtete Seiende war ein crUYXELIlEVOV,<br />
z. B. die Kreide und ihre Bestimmung <strong>der</strong> Stofflichkeit. Wir<br />
können auch eine Diagonale und die Inkommensurabilität<br />
<strong>der</strong>selben durch eine Seite des Vierecks heranziehen. Die<br />
crUYXELIlEVU sind uöUVU'"CU btULQC1'tijVUL, d. h. bezüglich ihrer besteht<br />
die Unmöglichkeit des Auseinan<strong>der</strong>nehmens, wenn das betreffende<br />
Seiende bestimmt sein soll. Dergleichen bezeichnet Aristoteles<br />
auch kurz als ubtutQnu. 32 Wir fragen: Gibt es noch ein höheres<br />
nicht Auseinan<strong>der</strong>nehmbares als das, was ständig und notwendig<br />
zusammengehört? Offenbar. Jenes, was überhaupt kein<br />
Beisammen des einen mit dem an<strong>der</strong>en ist, was überhaupt in sich<br />
kein Beisammen, kein cruv hat, das UcrUV1'tEtOV. Kurz und positiv<br />
die ucruv1'tETU gefaßt: '"Cu UJtAÜ. So ergibt sich folgende Reihe <strong>der</strong><br />
Untersuchung: cruIlßEß'l'JXO'"Cu, crUYXELIlEVU, uöUVU'"CU btULQE1'tijvUL,<br />
MtUtQE'"CU, ucr{,v1'tnu, UJtAÜ.<br />
Nicht jedes UbtUtQEtOv ist ein UJtAOUV, wohl aber umgekehrt,<br />
jedes UJtAOUV ist ein UbtU[QE'"COV und zwar im höchsten und eigentlichen<br />
Sinne, weil das Zusammengehörige nicht nur schlechthin<br />
unzertrennlich ist, son<strong>der</strong>n weil hier überhaupt kein Zusammengehöriges<br />
mehr vorkommt, weil es hier eben als Einfaches überhaupt<br />
nichts Zusammengehöriges zeigt. Wenn also das schlechthin<br />
Einfache entborgen ist in dem, was es ist, dann bringt es als<br />
Einfaches nie noch an<strong>der</strong>es mit, als welches es bestimmt werden<br />
müßte und könnte. Es ist nie und nimmer offenbar als das und<br />
das, son<strong>der</strong>n schlicht und schlechthin rein an ihm selbst nur es<br />
selbst. Die Entborgenheit des Einfachen an ihm selbst kann nie<br />
verstellt werden durch etwas, was dem Einfachen nicht zugehört.<br />
Diese Entborgenheit kann nicht deshalb nicht zur Verstelltheit<br />
werden, weil etwa ständig das dem Einfachen Zugehörige of-<br />
32 Aristoteles, De anima (Riehl/Apelt). Leipzig (Teubner) 1911. r 6,<br />
430 a 26 und b 6 ff.