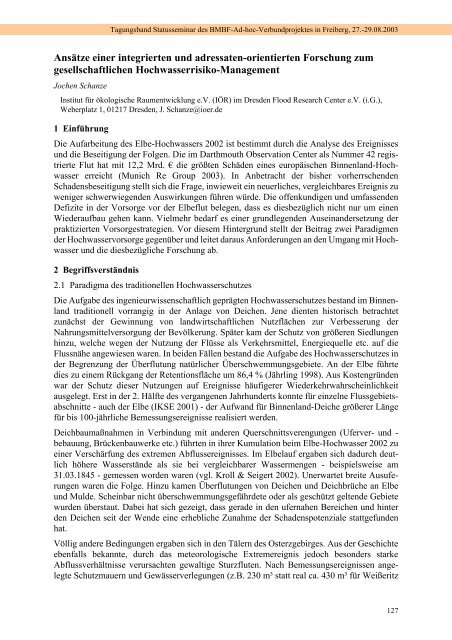Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Tagungsband</strong> Statusseminar des BMBF-Ad-hoc-Verbundprojektes in Freiberg, 27.-29.08.2003<br />
Ansätze einer integrierten und adressaten-orientierten Forschung zum<br />
gesellschaftlichen Hochwasserrisiko-Management<br />
Jochen Schanze<br />
Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR) im Dresden Flood Research Center e.V. (i.G.),<br />
Weberplatz 1, 01217 Dresden, J. Schanze@ioer.de<br />
1 Einführung<br />
Die Aufarbeitung des Elbe-Hochwassers 2002 ist bestimmt durch die Analyse des Ereignisses<br />
und die Beseitigung der Folgen. Die im Darthmouth Observation Center als Nummer 42 registrierte<br />
Flut hat mit 12,2 Mrd. € die größten Schäden eines europäischen Binnenland-Hochwasser<br />
erreicht (Munich Re Group 2003). In Anbetracht der bisher vorherrschenden<br />
Schadensbeseitigung stellt sich die Frage, inwieweit ein neuerliches, vergleichbares Ereignis zu<br />
weniger schwerwiegenden Auswirkungen führen würde. Die offenkundigen und umfassenden<br />
Defizite in der Vorsorge vor der Elbeflut belegen, dass es diesbezüglich nicht nur um einen<br />
Wiederaufbau gehen kann. Vielmehr bedarf es einer grundlegenden Auseinandersetzung der<br />
praktizierten Vorsorgestrategien. Vor diesem Hintergrund stellt der Beitrag zwei Paradigmen<br />
der Hochwasservorsorge gegenüber und leitet daraus Anforderungen an den Umgang mit Hochwasser<br />
und die diesbezügliche Forschung ab.<br />
2 Begriffsverständnis<br />
2.1 Paradigma des traditionellen Hochwasserschutzes<br />
Die Aufgabe des ingenieurwissenschaftlich geprägten Hochwasserschutzes bestand im Binnenland<br />
traditionell vorrangig in der Anlage von Deichen. Jene dienten historisch betrachtet<br />
zunächst der Gewinnung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Verbesserung der<br />
Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. Später kam der Schutz von größeren Siedlungen<br />
hinzu, welche wegen der Nutzung der Flüsse als Verkehrsmittel, Energiequelle etc. auf die<br />
Flussnähe angewiesen waren. In beiden Fällen bestand die Aufgabe des Hochwasserschutzes in<br />
der Begrenzung der Überflutung natürlicher Überschwemmungsgebiete. An der Elbe führte<br />
dies zu einem Rückgang der Retentionsfläche um 86,4 % (Jährling 1998). Aus Kostengründen<br />
war der Schutz dieser Nutzungen auf Ereignisse häufigerer Wiederkehrwahrscheinlichkeit<br />
ausgelegt. Erst in der 2. Hälfte des vergangenen Jahrhunderts konnte für einzelne Flussgebietsabschnitte<br />
- auch der Elbe (IKSE 2001) - der Aufwand für Binnenland-Deiche größerer Länge<br />
für bis 100-jährliche Bemessungsereignisse realisiert werden.<br />
Deichbaumaßnahmen in Verbindung mit anderen Querschnittsverengungen (Uferver- und -<br />
bebauung, Brückenbauwerke etc.) führten in ihrer Kumulation beim Elbe-Hochwasser 2002 zu<br />
einer Verschärfung des extremen Abflussereignisses. Im Elbelauf ergaben sich dadurch deutlich<br />
höhere Wasserstände als sie bei vergleichbarer Wassermengen - beispielsweise am<br />
31.03.1845 - gemessen worden waren (vgl. Kroll & Seigert 2002). Unerwartet breite Ausuferungen<br />
waren die Folge. Hinzu kamen Überflutungen von Deichen und Deichbrüche an Elbe<br />
und Mulde. Scheinbar nicht überschwemmungsgefährdete oder als geschützt geltende Gebiete<br />
wurden überstaut. Dabei hat sich gezeigt, dass gerade in den ufernahen Bereichen und hinter<br />
den Deichen seit der Wende eine erhebliche Zunahme der Schadenspotenziale stattgefunden<br />
hat.<br />
Völlig andere Bedingungen ergaben sich in den Tälern des Osterzgebirges. Aus der Geschichte<br />
ebenfalls bekannte, durch das meteorologische Extremereignis jedoch besonders starke<br />
Abflussverhältnisse verursachten gewaltige Sturzfluten. Nach Bemessungsereignissen angelegte<br />
Schutzmauern und Gewässerverlegungen (z.B. 230 m³ statt real ca. 430 m³ für Weißeritz<br />
127