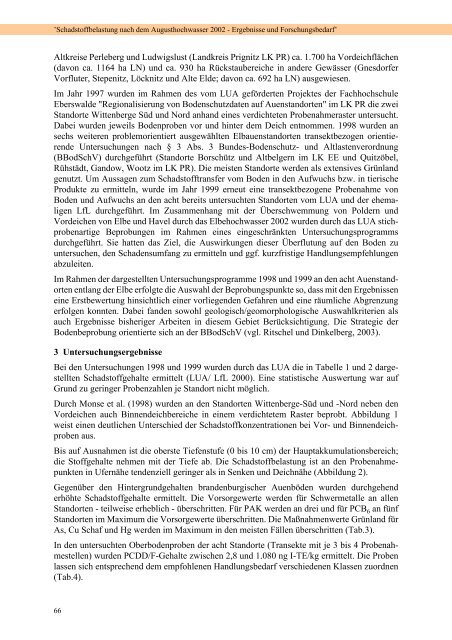Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
’Schadstoffbelastung nach dem Augusthochwasser 2002 - Ergebnisse und Forschungsbedarf’<br />
Altkreise Perleberg und Ludwigslust (Landkreis Prignitz LK PR) ca. 1.700 ha Vordeichflächen<br />
(davon ca. 1164 ha LN) und ca. 930 ha Rückstaubereiche in andere Gewässer (Gnesdorfer<br />
Vorfluter, Stepenitz, Löcknitz und Alte Elde; davon ca. 692 ha LN) ausgewiesen.<br />
Im Jahr 1997 wurden im Rahmen des vom LUA geförderten Projektes der Fachhochschule<br />
Eberswalde "Regionalisierung von Bodenschutzdaten auf Auenstandorten" im LK PR die zwei<br />
Standorte Wittenberge Süd und Nord anhand eines verdichteten Probenahmeraster untersucht.<br />
Dabei wurden jeweils Bodenproben vor und hinter dem Deich entnommen. 1998 wurden an<br />
sechs weiteren problemorientiert ausgewählten Elbauenstandorten transektbezogen orientierende<br />
Untersuchungen nach § 3 Abs. 3 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung<br />
(BBodSchV) durchgeführt (Standorte Borschütz und Altbelgern im LK EE und Quitzöbel,<br />
Rühstädt, Gandow, Wootz im LK PR). Die meisten Standorte werden als extensives Grünland<br />
genutzt. Um Aussagen zum Schadstofftransfer vom Boden in den Aufwuchs bzw. in tierische<br />
Produkte zu ermitteln, wurde im Jahr 1999 erneut eine transektbezogene Probenahme von<br />
Boden und Aufwuchs an den acht bereits untersuchten Standorten vom LUA und der ehemaligen<br />
LfL durchgeführt. Im Zusammenhang mit der Überschwemmung von Poldern und<br />
Vordeichen von Elbe und Havel durch das Elbehochwasser 2002 wurden durch das LUA stichprobenartige<br />
Beprobungen im Rahmen eines eingeschränkten Untersuchungsprogramms<br />
durchgeführt. Sie hatten das Ziel, die Auswirkungen dieser Überflutung auf den Boden zu<br />
untersuchen, den Schadensumfang zu ermitteln und ggf. kurzfristige Handlungsempfehlungen<br />
abzuleiten.<br />
Im Rahmen der dargestellten Untersuchungsprogramme 1998 und 1999 an den acht Auenstandorten<br />
entlang der Elbe erfolgte die Auswahl der Beprobungspunkte so, dass mit den Ergebnissen<br />
eine Erstbewertung hinsichtlich einer vorliegenden Gefahren und eine räumliche Abgrenzung<br />
erfolgen konnten. Dabei fanden sowohl geologisch/geomorphologische Auswahlkriterien als<br />
auch Ergebnisse bisheriger Arbeiten in diesem Gebiet Berücksichtigung. Die Strategie der<br />
Bodenbeprobung orientierte sich an der BBodSchV (vgl. Ritschel und Dinkelberg, 2003).<br />
3 Untersuchungsergebnisse<br />
Bei den Untersuchungen 1998 und 1999 wurden durch das LUA die in Tabelle 1 und 2 dargestellten<br />
Schadstoffgehalte ermittelt (LUA/ LfL 2000). Eine statistische Auswertung war auf<br />
Grund zu geringer Probenzahlen je Standort nicht möglich.<br />
Durch Monse et al. (1998) wurden an den Standorten Wittenberge-Süd und -Nord neben den<br />
Vordeichen auch Binnendeichbereiche in einem verdichtetem Raster beprobt. Abbildung 1<br />
weist einen deutlichen Unterschied der Schadstoffkonzentrationen bei Vor- und Binnendeichproben<br />
aus.<br />
Bis auf Ausnahmen ist die oberste Tiefenstufe (0 bis 10 cm) der Hauptakkumulationsbereich;<br />
die Stoffgehalte nehmen mit der Tiefe ab. Die Schadstoffbelastung ist an den Probenahmepunkten<br />
in Ufernähe tendenziell geringer als in Senken und Deichnähe (Abbildung 2).<br />
Gegenüber den Hintergrundgehalten brandenburgischer Auenböden wurden durchgehend<br />
erhöhte Schadstoffgehalte ermittelt. Die Vorsorgewerte werden für Schwermetalle an allen<br />
Standorten - teilweise erheblich - überschritten. Für PAK werden an drei und für PCB 6 an fünf<br />
Standorten im Maximum die Vorsorgewerte überschritten. Die Maßnahmenwerte Grünland für<br />
As, Cu Schaf und Hg werden im Maximum in den meisten Fällen überschritten (Tab.3).<br />
In den untersuchten Oberbodenproben der acht Standorte (Transekte mit je 3 bis 4 Probenahmestellen)<br />
wurden PCDD/F-Gehalte zwischen 2,8 und 1.080 ng I-TE/kg ermittelt. Die Proben<br />
lassen sich entsprechend dem empfohlenen Handlungsbedarf verschiedenen Klassen zuordnen<br />
(Tab.4).<br />
66