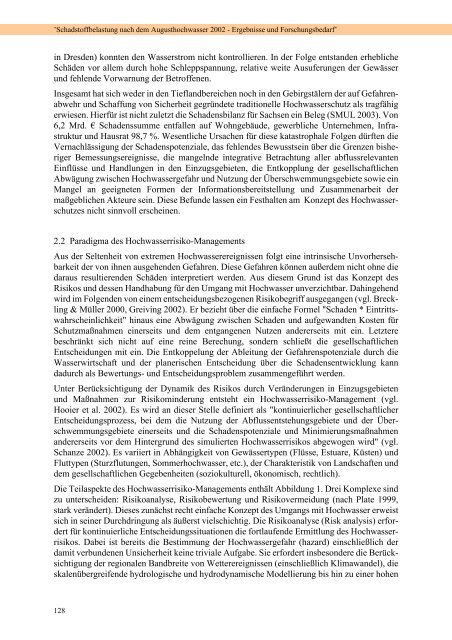Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
’Schadstoffbelastung nach dem Augusthochwasser 2002 - Ergebnisse und Forschungsbedarf’<br />
in Dresden) konnten den Wasserstrom nicht kontrollieren. In der Folge entstanden erhebliche<br />
Schäden vor allem durch hohe Schleppspannung, relative weite Ausuferungen der Gewässer<br />
und fehlende Vorwarnung der Betroffenen.<br />
Insgesamt hat sich weder in den Tieflandbereichen noch in den Gebirgstälern der auf Gefahrenabwehr<br />
und Schaffung von Sicherheit gegründete traditionelle Hochwasserschutz als tragfähig<br />
erwiesen. Hierfür ist nicht zuletzt die Schadensbilanz für Sachsen ein Beleg (SMUL 2003). Von<br />
6,2 Mrd. € Schadenssumme entfallen auf Wohngebäude, gewerbliche Unternehmen, Infrastruktur<br />
und Hausrat 98,7 %. Wesentliche Ursachen für diese katastrophale Folgen dürften die<br />
Vernachlässigung der Schadenspotenziale, das fehlendes Bewusstsein über die Grenzen bisheriger<br />
Bemessungsereignisse, die mangelnde integrative Betrachtung aller abflussrelevanten<br />
Einflüsse und Handlungen in den Einzugsgebieten, die Entkopplung der gesellschaftlichen<br />
Abwägung zwischen Hochwassergefahr und Nutzung der Überschwemmungsgebiete sowie ein<br />
Mangel an geeigneten Formen der Informationsbereitstellung und Zusammenarbeit der<br />
maßgeblichen Akteure sein. Diese Befunde lassen ein Festhalten am Konzept des Hochwasserschutzes<br />
nicht sinnvoll erscheinen.<br />
2.2 Paradigma des Hochwasserrisiko-Managements<br />
Aus der Seltenheit von extremen Hochwasserereignissen folgt eine intrinsische Unvorhersehbarkeit<br />
der von ihnen ausgehenden Gefahren. Diese Gefahren können außerdem nicht ohne die<br />
daraus resultierenden Schäden interpretiert werden. Aus diesem Grund ist das Konzept des<br />
Risikos und dessen Handhabung für den Umgang mit Hochwasser unverzichtbar. Dahingehend<br />
wird im Folgenden von einem entscheidungsbezogenen Risikobegriff ausgegangen (vgl. Breckling<br />
& Müller 2000, Greiving 2002). Er bezieht über die einfache Formel "Schaden * Eintrittswahrscheinlichkeit"<br />
hinaus eine Abwägung zwischen Schaden und aufgewandten Kosten für<br />
Schutzmaßnahmen einerseits und dem entgangenen Nutzen andererseits mit ein. Letztere<br />
beschränkt sich nicht auf eine reine Berechung, sondern schließt die gesellschaftlichen<br />
Entscheidungen mit ein. Die Entkoppelung der Ableitung der Gefahrenspotenziale durch die<br />
Wasserwirtschaft und der planerischen Entscheidung über die Schadensentwicklung kann<br />
dadurch als Bewertungs- und Entscheidungsproblem zusammengeführt werden.<br />
Unter Berücksichtigung der Dynamik des Risikos durch Veränderungen in Einzugsgebieten<br />
und Maßnahmen zur Risikominderung entsteht ein Hochwasserrisiko-Management (vgl.<br />
Hooier et al. 2002). Es wird an dieser Stelle definiert als "kontinuierlicher gesellschaftlicher<br />
Entscheidungsprozess, bei dem die Nutzung der Abflussentstehungsgebiete und der Überschwemmungsgebiete<br />
einerseits und die Schadenspotenziale und Minimierungsmaßnahmen<br />
andererseits vor dem Hintergrund des simulierten Hochwasserrisikos abgewogen wird" (vgl.<br />
Schanze 2002). Es variiert in Abhängigkeit von Gewässertypen (Flüsse, Estuare, Küsten) und<br />
Fluttypen (Sturzflutungen, Sommerhochwasser, etc.), der Charakteristik von Landschaften und<br />
dem gesellschaftlichen Gegebenheiten (soziokulturell, ökonomisch, rechtlich).<br />
Die Teilaspekte des Hochwasserrisiko-Managements enthält Abbildung 1. Drei Komplexe sind<br />
zu unterscheiden: Risikoanalyse, Risikobewertung und Risikovermeidung (nach Plate 1999,<br />
stark verändert). Dieses zunächst recht einfache Konzept des Umgangs mit Hochwasser erweist<br />
sich in seiner Durchdringung als äußerst vielschichtig. Die Risikoanalyse (Risk analysis) erfordert<br />
für kontinuierliche Entscheidungssituationen die fortlaufende Ermittlung des Hochwasserrisikos.<br />
Dabei ist bereits die Bestimmung der Hochwassergefahr (hazard) einschließlich der<br />
damit verbundenen Unsicherheit keine triviale Aufgabe. Sie erfordert insbesondere die Berücksichtigung<br />
der regionalen Bandbreite von Wetterereignissen (einschließlich Klimawandel), die<br />
skalenübergreifende hydrologische und hydrodynamische Modellierung bis hin zu einer hohen<br />
128