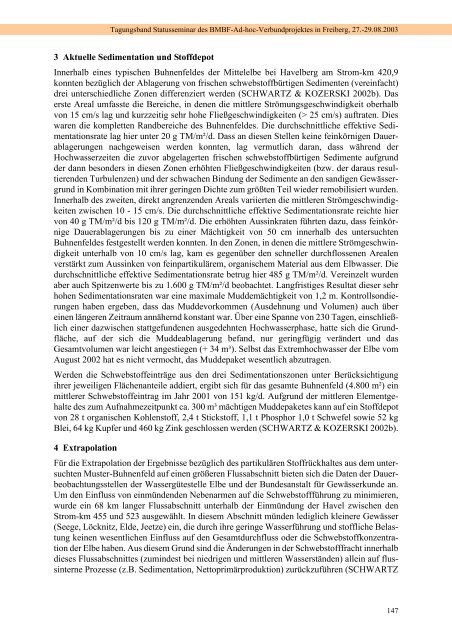Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Tagungsband - UFZ
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Tagungsband</strong> Statusseminar des BMBF-Ad-hoc-Verbundprojektes in Freiberg, 27.-29.08.2003<br />
3 Aktuelle Sedimentation und Stoffdepot<br />
Innerhalb eines typischen Buhnenfeldes der Mittelelbe bei Havelberg am Strom-km 420,9<br />
konnten bezüglich der Ablagerung von frischen schwebstoffbürtigen Sedimenten (vereinfacht)<br />
drei unterschiedliche Zonen differenziert werden (SCHWARTZ & KOZERSKI 2002b). Das<br />
erste Areal umfasste die Bereiche, in denen die mittlere Strömungsgeschwindigkeit oberhalb<br />
von 15 cm/s lag und kurzzeitig sehr hohe Fließgeschwindigkeiten (> 25 cm/s) auftraten. Dies<br />
waren die kompletten Randbereiche des Buhnenfeldes. Die durchschnittliche effektive Sedimentationsrate<br />
lag hier unter 20 g TM/m²/d. Dass an diesen Stellen keine feinkörnigen Dauerablagerungen<br />
nachgeweisen werden konnten, lag vermutlich daran, dass während der<br />
Hochwasserzeiten die zuvor abgelagerten frischen schwebstoffbürtigen Sedimente aufgrund<br />
der dann besonders in diesen Zonen erhöhten Fließgeschwindigkeiten (bzw. der daraus resultierenden<br />
Turbulenzen) und der schwachen Bindung der Sedimente an den sandigen Gewässergrund<br />
in Kombination mit ihrer geringen Dichte zum größten Teil wieder remobilisiert wurden.<br />
Innerhalb des zweiten, direkt angrenzenden Areals variierten die mittleren Strömgeschwindigkeiten<br />
zwischen 10 - 15 cm/s. Die durchschnittliche effektive Sedimentationsrate reichte hier<br />
von 40 g TM/m²/d bis 120 g TM/m²/d. Die erhöhten Aussinkraten führten dazu, dass feinkörnige<br />
Dauerablagerungen bis zu einer Mächtigkeit von 50 cm innerhalb des untersuchten<br />
Buhnenfeldes festgestellt werden konnten. In den Zonen, in denen die mittlere Strömgeschwindigkeit<br />
unterhalb von 10 cm/s lag, kam es gegenüber den schneller durchflossenen Arealen<br />
verstärkt zum Aussinken von feinpartikulärem, organischem Material aus dem Elbwasser. Die<br />
durchschnittliche effektive Sedimentationsrate betrug hier 485 g TM/m²/d. Vereinzelt wurden<br />
aber auch Spitzenwerte bis zu 1.600 g TM/m²/d beobachtet. Langfristiges Resultat dieser sehr<br />
hohen Sedimentationsraten war eine maximale Muddemächtigkeit von 1,2 m. Kontrollsondierungen<br />
haben ergeben, dass das Muddevorkommen (Ausdehnung und Volumen) auch über<br />
einen längeren Zeitraum annähernd konstant war. Über eine Spanne von 230 Tagen, einschließlich<br />
einer dazwischen stattgefundenen ausgedehnten Hochwasserphase, hatte sich die Grundfläche,<br />
auf der sich die Muddeablagerung befand, nur geringfügig verändert und das<br />
Gesamtvolumen war leicht angestiegen (+ 34 m³). Selbst das Extremhochwasser der Elbe vom<br />
August 2002 hat es nicht vermocht, das Muddepaket wesentlich abzutragen.<br />
Werden die Schwebstoffeinträge aus den drei Sedimentationszonen unter Berücksichtigung<br />
ihrer jeweiligen Flächenanteile addiert, ergibt sich für das gesamte Buhnenfeld (4.800 m²) ein<br />
mittlerer Schwebstoffeintrag im Jahr 2001 von 151 kg/d. Aufgrund der mittleren Elementgehalte<br />
des zum Aufnahmezeitpunkt ca. 300 m³ mächtigen Muddepaketes kann auf ein Stoffdepot<br />
von 28 t organischen Kohlenstoff, 2,4 t Stickstoff, 1,1 t Phosphor 1,0 t Schwefel sowie 52 kg<br />
Blei, 64 kg Kupfer und 460 kg Zink geschlossen werden (SCHWARTZ & KOZERSKI 2002b).<br />
4 Extrapolation<br />
Für die Extrapolation der Ergebnisse bezüglich des partikulären Stoffrückhaltes aus dem untersuchten<br />
Muster-Buhnenfeld auf einen größeren Flussabschnitt bieten sich die Daten der Dauerbeobachtungsstellen<br />
der Wassergütestelle Elbe und der Bundesanstalt für Gewässerkunde an.<br />
Um den Einfluss von einmündenden Nebenarmen auf die Schwebstoffführung zu minimieren,<br />
wurde ein 68 km langer Flussabschnitt unterhalb der Einmündung der Havel zwischen den<br />
Strom-km 455 und 523 ausgewählt. In diesem Abschnitt münden lediglich kleinere Gewässer<br />
(Seege, Löcknitz, Elde, Jeetze) ein, die durch ihre geringe Wasserführung und stoffliche Belastung<br />
keinen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtdurchfluss oder die Schwebstoffkonzentration<br />
der Elbe haben. Aus diesem Grund sind die Änderungen in der Schwebstofffracht innerhalb<br />
dieses Flussabschnittes (zumindest bei niedrigen und mittleren Wasserständen) allein auf flussinterne<br />
Prozesse (z.B. Sedimentation, Nettoprimärproduktion) zurückzuführen (SCHWARTZ<br />
147