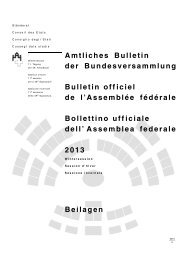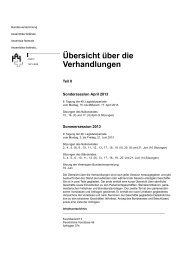Beilagen â Ständerat - Schweizer Parlament
Beilagen â Ständerat - Schweizer Parlament
Beilagen â Ständerat - Schweizer Parlament
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wirtschaftszusammenarbeit abbilden.<br />
Ferner wies die <strong>Schweizer</strong> Delegation darauf hin, dass es bei den bilateralen Gesprächen über die institutionellen Fragen Probleme geben könnte, falls die<br />
Bevölkerung ihres Landes das Gefühl habe, die EU mische sich in ihre staatspolitischen Angelegenheiten ein. Die Schweiz wolle ihre Souveränität wahren und mit<br />
der EU gemäss dem in der Schweiz vorherrschenden Subsidiaritätsprinzip zusammenarbeiten.<br />
Abschliessend begrüssten beide Delegationen den Ausbau der Kontakte zwischen ihren <strong>Parlament</strong>en.<br />
4. 1. 2. Personenfreizügigkeit: Probleme beim freien Dienstleistungsverkehr<br />
Die Personenfreizügigkeit stand ebenfalls auf dem Programm. Als Einleitung zu diesem Thema wurden die bestehenden Probleme dargelegt. Die <strong>Schweizer</strong><br />
Delegation wies darauf hin, dass die vollständige Umsetzung der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit die Schweiz wie auch ihre Nachbarländer vor<br />
eine schwierige Aufgabe stellt, insbesondere was die Sozialversicherungen und die Lohnverhältnisse anbelangt. Besonders besorgt sei die Schweiz über das<br />
Lohndumping als Folge des freien Dienstleistungsverkehrs. Zahlreiche in der Schweiz tätige Unternehmen würden die arbeitsrechtlichen Bestimmungen nämlich nicht<br />
einhalten. Um hier Abhilfe zu schaffen, überwache die Schweiz gemäss dem Entsendegesetz verstärkt den Arbeitsmarkt. Dabei sei die Voranmeldefrist für<br />
europäische Dienstleistungserbringer unabdingbar zur Bekämpfung des Lohndumpings und zur Sicherstellung der Kontrollverfahren. Die <strong>Schweizer</strong> Delegation räumte<br />
ein, dass sich das Voranmeldeverfahren für die Dienstleister aus der EU als kompliziert erwiesen hat, betonte aber auch, dass dieses mittlerweile stark vereinfacht<br />
und u. a. eine Internetseite eingerichtet worden ist, mit welcher der administrative Aufwand empfindlich abgenommen hat.<br />
Zudem kam die <strong>Schweizer</strong> Delegation auf die Problematik zu sprechen, dass entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Ferien doppelt bezahlt werden,<br />
nämlich vom <strong>Schweizer</strong> wie auch vom ausländischen Betrieb. Ausserdem sagte sie, dass die Kautionspflicht, welche die Schweiz gewissen ausländischen<br />
Unternehmen auferlegt, abgeschafft werden kann, wenn die Bussen, die für Verstösse gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen vorgesehen sind, gegenseitig anerkannt<br />
und eingehalten werden.<br />
Die EUDelegation wies auf die vollständige Integration des EUBinnenmarktes, die von allen Mitgliedstaaten einheitlich angewendeten Regeln und die klar definierten<br />
Rechtsverfahren hin, mit denen Handelshemmnisse vermieden werden könnten. Auf diese Weise würde Rechtssicherheit für die europäischen Wirtschaftsakteure<br />
geschaffen. Eines der wichtigsten Probleme, dass es hinsichtlich der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und der Schweiz zu lösen gilt, ist in den Augen der<br />
EUDelegation eben gerade die Rechtsunsicherheit. Diese schrecke gewisse europäische Investoren ab. Die <strong>Schweizer</strong> Delegation entgegnete darauf, dass die<br />
Zahlen eine andere Sprache sprechen und vom Vertrauen der in der Schweiz tätigen europäischen Wirtschaftsakteure in die Rechtssicherheit zeugen. Die Zahl der<br />
entsandten Arbeitnhemende von 90'000 im Jahr 2005 auf 150'000 im Jahr 2010 gestiegen.<br />
Beide Seiten waren sich einig, dass für die angesprochenen Probleme Lösungen gefunden werden müssen. Grundsätzlich seien die bestehenden Differenzen jedoch<br />
eher geringfügig und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sehr eng und für beide Seiten profitabel. Kleinere Spannungen zwischen den beiden Parteien<br />
zeugten lediglich von der Intensität der Beziehungen.<br />
4. 1. 3. Europäische Energiepolitik<br />
Einleitend erinnerten die Delegationen daran, dass die laufenden Verhandlungen für ein Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU 2007 begonnen haben<br />
und sich der Bereich der Energieversorgung seither rasant entwickelt hat. Die EUMitgliedstaaten hätten sich verpflichtet, den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20<br />
Prozent zu senken (Ziel 20/20/20), und das Verhandlungsmandat sei entsprechend angepasst worden.<br />
Die <strong>Schweizer</strong> Delegation hielt fest, dass ein umfassendes Stromabkommen im Interesse der Schweiz und der EU liegt. Aufgrund ihrer geografischen Lage sei die<br />
Schweiz Stromdrehscheibe Europas, weshalb es zwischen der EU und der Schweiz einen regen Handel gebe.<br />
Die Delegation des EU<strong>Parlament</strong>s erklärte, die EU strebe ein Europa ohne Fossilenergie an, auch wenn noch nicht klar sei, wann dieses Ziel erreicht werden könne.<br />
Nationale Aktionspläne würden ausgearbeitet, um über den Wettbewerb den Differenzierungsprozess voranzutreiben. Wichtige Fragen seien die Besteuerung und die<br />
sinnvolle Verwendung der Einnahmen aus dem EUEmissionshandel (European Union Emission Trading System); Letzteres solle gut überlegt sein.<br />
Die EUDelegation kam zudem auf das Unglück in Fukushima zu sprechen. Wie vorherige Nuklearunfälle habe auch diese Katastrophe gezeigt, dass sich die<br />
Nationalstaaten nicht dreinreden lassen möchten. Die Notstromversorgung bei Naturkatastrophen oder anderen Gefahren müsse jedoch sichergestellt werden. Es<br />
stelle sich zumindest die Frage nach Regulierungen. Klar sei, dass ein transparentes System mit verbindlichen Sicherheits und Sicherungsstandards benötigt werde.<br />
Fragen seien die Besteuerung und die sinnvolle Verwendung der Einnahmen aus dem EUEmissionshandel (European Union Emission Trading System); Letzteres<br />
solle gut überlegt sein.<br />
Die EUDelegation kam zudem auf das Unglück in Fukushima zu sprechen. Wie vorherige Nuklearunfälle habe auch diese Katastrophe gezeigt, dass sich die<br />
Nationalstaaten nicht dreinreden lassen möchten. Die Notstromversorgung bei Naturkatastrophen oder anderen Gefahren müsse jedoch sichergestellt werden. Es<br />
stelle sich zumindest die Frage nach Regulierungen. Klar sei, dass ein transparentes System mit verbindlichen Sicherheits und Sicherungsstandards benötigt werde.<br />
4. 1. 4. Verkehrspolitik der Schweiz und der EU<br />
Die beiden Delegationen diskutierten eingehend über die Verkehrspolitik in Europa. Im Mittelpunkt dieser Gespräche stand der NordSüdKorridor, wobei vorwiegend<br />
über die Neue Alpentransversale (NEAT) und ihre Nord bzw. Südanschlüsse gesprochen wurde.<br />
Die europäische Delegation betonte, wie wichtig es ist, im Bereich der Verkehrspolitik effizient mit der Schweiz zusammenzuarbeiten. Dazu würden zahlreiche<br />
bestehende Abkommen und der ständige Dialog beitragen. Die Infrastruktur sei für die Entwicklung des Verkehrswesens von zentraler Bedeutung. Zudem sei es<br />
wichtig, dass das Verursacherprinzip angewendet werde, wonach die sozialen Kosten einer wirtschaftlichen Aktivität vom Verursacher zu tragen sind. Der<br />
Entwicklungsstand und die Ziele der einzelnen Länder seien unterschiedlich: Während die Infrastruktur mancherorts gut ausgebaut sei, bestehe in anderen Ländern<br />
ein hoher Investitionsbedarf. Demensprechend würden hier auch die Meinungen im EU<strong>Parlament</strong> stark auseinandergehen. Die EUDelegation hielt fest, dass die<br />
Schweiz in dieser Sache sehr weit ist. Dazu gratuliere die Europäische Kommission wie auch der EUMinisterrat.<br />
Giovanni Lombardi, renommierter Bauingenieur für Tunnel und Talsperrenprojekte, hielt ein Referat über die NEAT. Zu seinen Projekten gehören zahlreiche Tunnel, so<br />
der GotthardStrassentunnel, der GotthardBasistunnel und die NEAT wie auch viele weitere Projekte im In und Ausland. Lombardi erläuterte in seinem Referat, wie<br />
bedeutend der Gotthardtunnel und der Gotthardpass im Allgemeinen sind. Seit vielen Jahren ist diese Durchgangsstrecke eine wichtige Verbindung zwischen Nord<br />
und Süd. Er zeigte zudem die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Tunnelbaus auf, welche dank der neuesten Technik gemeistert werden konnten.<br />
Nach den Ausführungen von Giovanni Lombardi, die einen Überblick über die Bautätigkeit der Schweiz in diesem Bereich vermittelten, wurde über die Nord und<br />
Südanschlüsse der NEAT diskutiert. Die Schweiz hat sowohl mit dem südlichen wie auch mit dem nördlichen Nachbarland ein Abkommen abgeschlossen, welches<br />
die Entwicklung der Bahninfrastruktur zwischen ihr und diesen beiden Staaten regelt. Der Bau der Zufahrtslinien ist jedoch mit gewissen Schwierigkeiten verbunden.<br />
Die <strong>Schweizer</strong> Delegation betonte, wie wichtig diese Infrastruktur für die wirtschaftliche Entwicklung und die Kooperation zwischen den Ländern ist. Ein äusserst<br />
grosser Teil des alpenquerenden Verkehrs erfolge auf der Schiene. Die Einführung der Schwerverkehrsabgabe habe sich positiv ausgewirkt: Mit dieser Abgabe konnte<br />
die NEAT mitfinanziert und der Verkehr durch die Alpen stabilisiert werden. Zudem hob die <strong>Schweizer</strong> Delegation hervor, dass ihr Land der EU diese Tunnel für den<br />
Güter und Personentransport zur Verfügung stellt. Sie wies darauf hin, dass der Güterverkehr in den nächsten zwanzig Jahren voraussichtlich um 70 bis 75 Prozent,<br />
der Personenverkehr um 70 Prozent zunehmen wird und die von der Schweiz finanzierten Infrastrukturen deshalb für den Handel zwischen Nord und Südeuropa<br />
unabdingbar sind.<br />
Die <strong>Schweizer</strong> Delegation hielt auch fest, dass die Schweiz und Italien in der Verkehrspolitik Meinungsverschiedenheiten hätten: Während die Schweiz möglichst<br />
viele Güter von der Strasse auf die Schiene bringen möchte, räumt Italien Hochgeschwindigkeitsstrecken Priorität ein. Doch sei man sich in Anbetracht der<br />
Verkehrszunahme einig, dass der Güterverkehr über die NEAT erfolgen müsse. Zwischen Chiasso und Mailand seien hierfür jedoch noch beträchtliche Investitionen<br />
nötig. Die Finanzierung der Investitionen der Schweiz sei bis 2030 gesichert. Was Deutschland betreffe, so sei zwischen Karlsruhe und Basel ein Ausbau von zwei<br />
auf vier Gleise vorgesehen. Dieser Ausbau gehe aber nur langsam voran. Ein weiteres Problem bestehe bei der Gäubahn, welche Stuttgart und Zürich direkt verbinde.<br />
Die <strong>Schweizer</strong> Delegation bezweifelte, dass die Zufahrtslinien zur NEAT fristgerecht fertiggestellt werden können.<br />
Nach dem bilateralen Treffen besichtigten die beiden Delegationen die AlptransitBaustelle in Pollegio.<br />
Die EUDelegation zeigte sich beeindruckt über die Investitionen der Schweiz in die Alpentransversalen. Mit einer gemeinsamen Erklärung, die Gegenstand des<br />
nächsten Kapitels (4.1.5) ist, riefen die beiden Delegationen die Nachbarländer der Schweiz auf, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass die Zufahrtslinien zur Neuen<br />
EisenbahnAlpentransversale gewährleistet sind.<br />
201