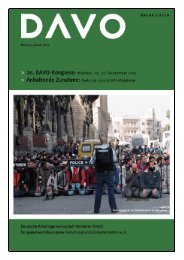4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
nes Blocks, der den Demokraten gegenübersteht, dominant.<br />
Insgesamt verbleibt Abdel-Samads Wahrnehmung<br />
der Revolution stark im Rahmen eines<br />
Nachholens, was angesichts der OccupyWallstreet &<br />
Co. Bewegungen nun jedoch neu diskutiert wird.<br />
Anstatt alle Faktoren zu untersuchen, die Revolu<strong>tionen</strong><br />
dieser Art "erst jetzt" stattfinden lassen, sucht er<br />
vor allem in der kulturell <strong>und</strong> religiös geprägten Mentalität<br />
seiner L<strong>and</strong>sleute nach Erklärungen. Dabei<br />
scheint durchaus durch, wie das Mubarak-System<br />
nicht zuletzt dank internationalem Interesse funktioniert<br />
hat. Dies prangert er in Bezug auf Saudi-Arabien<br />
zu Recht an <strong>und</strong> leitet daraus eine eher pessimistische<br />
Einschätzung für die weitere Entwicklung in der Region<br />
ab.<br />
Sein Exkurs in die Medienentwicklung seit der<br />
Gründung Al Jazeeras mag für Einsteiger durchaus interessant<br />
sein, die Unbedarftheit des Autors bezüglich<br />
der Medienthematik wird aber spätestens an der Stelle<br />
deutlich, wo er meint, dass neue Medien durch Werbeeinnahmen<br />
unabhängig sein würden. Ähnlich naiv<br />
kommt das Kapitel „Der Weg nach Gaza führt über<br />
den Tahrirplatz“ daher, wo er auf wenigen Seiten den<br />
Nahostkonflikt löst – jedoch unter Bedienung des<br />
Camp-David-Mythos sowie unter Auslassung der<br />
kürzlich veröffentlichten Palestine Papers. Auch seine<br />
Meinung, dass in Deutschl<strong>and</strong> „die religiöse Dimension<br />
des Terrorismus in der politischen Debatte kaum<br />
Beachtung findet“ wirkt angesichts der nachweisbaren<br />
Endlosdebatte zum Thema genau unter dem Aspekt<br />
„Islam(-ismus)“ nur mehr lächerlich. Zuzustimmen ist<br />
ihm jedoch bei der Feststellung, dass sich aktuelle<br />
Konflikte hüben wie drüben nicht mit interreligiösem<br />
Dialog lösen lassen werden – allerdings analysiert er<br />
nicht, wer dieses Konzept zu welchen Zwecken propagiert.<br />
Insgesamt spielen Machtgefälle in seiner Art<br />
der Betrachtung allenfalls eine untergeordnete Rolle.<br />
Sein letztes Kapitel "Marschallplan für die arabische<br />
Welt" zeugt von Unkenntnis der Ist-Situation, wobei<br />
er sympathischerweise selbst einräumt, von Wirtschaft<br />
nichts zu verstehen. Seine Vorschläge zur Kooperation<br />
mit der arabischen Welt, wobei er ständig<br />
zwischen Ägypten <strong>und</strong> einer Verallgemeinerung auf<br />
alle arabischen Länder oder gar „die islamische Welt“<br />
pendelt, sind bereits weitestgehend realisiert (s. z.B.<br />
Zulieferbetriebe in Tunesien) <strong>und</strong> Teil des Problems.<br />
Zwar klingen faire H<strong>and</strong>elsbeziehungen als Gr<strong>und</strong>voraussetzung<br />
für eine echte Hilfe an, aber hierzu entwickelt<br />
er keine Visionen. Stattdessen fällt ein Nichtinfragestellen<br />
gängiger Mythen auf, die in unseren<br />
Mainstream-Medien kursieren. So übernimmt er unkritisch<br />
die Behauptung eines Fachkräftemangels, um<br />
entsprechend seiner stets gepflegten Dichotomie von<br />
Wissen hier <strong>und</strong> Unwissen dort eine Symbiose zwischen<br />
westlichem Know-How <strong>und</strong> arabischer Manpower<br />
vorzuschlagen. Wie viele Zeitgenossen ist ihm<br />
das Konzept des jobless growth völlig unbekannt, das<br />
in den Wirtschaftswissenschaften bereits vor Jahrzehnten<br />
gelehrt wurde <strong>und</strong> welches das bezeichnet,<br />
was wir heute allerorten beobachten können: Wachstum<br />
ohne Arbeit <strong>und</strong> eine breite Prekarisierung.<br />
So beeindruckend seine Ereignisschilderungen vom<br />
158<br />
Tahrir-Platz sind <strong>und</strong> so bew<strong>und</strong>ernswert es ist, dass<br />
er unumw<strong>und</strong>en ins Flugzeug stieg, als die Proteste in<br />
Kairo losgingen, so bedient Abdel-Samad weiterhin<br />
den hiesigen Zeitgeist der Überlegenheit – was ihm<br />
die weitere Medienaufmerksamkeit garantieren dürfte,<br />
da er damit ein Gr<strong>und</strong>bedürfnis stillt <strong>und</strong> man im Medienbetrieb<br />
ja nicht dem wissenschaftlichen Forschungsst<strong>and</strong><br />
verpflichtet ist. Das wenig später erschienene<br />
„Tagebuch der arabischen Revolution „von<br />
Karim El-Gawhary atmet da eher einen Geist der Anerkennung,<br />
auch ohne Probleme zu leugnen.<br />
Hingegen w<strong>und</strong>ert es nach der Lektüre Hamed Abdel-Samads<br />
nicht, dass er in Bezug auf die aktuelle<br />
Eskalation in Ägypten auf das religiöse Framing hereinfällt<br />
<strong>und</strong> nicht das sieht, was beispielsweise Sonja<br />
Zekri in ihren Kommentaren in der Süddeutschen Zeitung<br />
bemerkt: Die Instrumentalisierung der koptischen<br />
Minderheit als Teil der Konterrevolution. Tatsächlich<br />
trägt eine Allianz aus Exilkopten <strong>und</strong> Evangelikalen<br />
massiv dazu bei, dass die traurigen Ereignisse<br />
vom 9. Oktober 2011 in Kairo, wo gezielt Kopten<br />
von Schlägern angegriffen <strong>und</strong> von Panzern überfahren<br />
wurden, als Teil einer „systematischen Christenverfolgung“<br />
einzuordnen seien. Dabei haben Kenner<br />
der Region genau davor gewarnt, dass nämlich die<br />
lange kultivierten religionisierten Framings, die nicht<br />
zuletzt der Propag<strong>and</strong>a von Diktatoren wie Mubarak<br />
entsprangen, so stark sind, dass sie dazu verleiten die<br />
Gegenkräfte der Demokratiebewegung nicht als das<br />
zu entlarven, was sie sind: Profiteure eines untergehenden<br />
Wirtschaftssystems.<br />
Sabine Schiffer, Erlangen<br />
� � �<br />
Albrecht, Sarah (2010): Islamisches Minderheitenrecht,<br />
Yūsuf al-Qaradāwīs Konzept des fiqh alaqallīyāt.<br />
– Ergon: Würzburg, 119 S.<br />
Das „Phänomen Yusuf al-Qaradawi“ – so der Untertitel<br />
eines 2009 von Bettina Gräf <strong>und</strong> Jakob Skovgaard-<br />
Petersen herausgegebenen Buches – wird schon seit<br />
einigen Jahren wissenschaftlich untersucht. Auch Bettina<br />
Gräfs 2010 erschienene Dissertation Medien-<br />
Fatwas@Yusuf al-Qaradawi beleuchtet das Wirken<br />
des in Katar ansässigen Gelehrten. Sarah Albrecht<br />
konnte beim Verfassen ihrer Magisterarbeit über al-<br />
Qaradāwīs Konzept des islamischen Minderheitenrechts<br />
(fiqh al-aqalliyyāt) bereits auf Gräfs seinerzeit<br />
noch unveröffentlichtes Manuskript zurückgreifen.<br />
Nach einer knappen Diskussion der wesentlichen<br />
Erkenntnisse zum islamischen Minderheitenrecht <strong>und</strong><br />
einem Abriss der Biographie des 1926 in Ägypten geborenen<br />
Yūsuf al-Qaradāwī untersucht Albrecht insbesondere<br />
dessen Werk Fī fiqh al-aqalliyyāt almuslima<br />
(2001, 2. Aufl. 2005). Ziel ihrer Arbeit ist<br />
dabei die Analyse von al-Qaradāwīs Quellen, Methoden<br />
<strong>und</strong> Prinzipien sowie der Themen, die sich in seinen<br />
Fatwas widerspiegeln. Sie beabsichtigt, daraus<br />
Rückschlüsse auf sein Bild von nichtmuslimischen<br />
Mehrheitsgesellschaften zu ziehen.<br />
Um islamische Normen in Minderheitskontexten effektiv<br />
anzuwenden, stützt sich al-Qaradāwī demnach