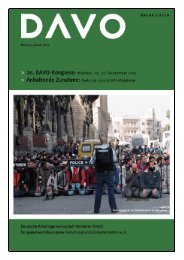4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
ben der Religionen in der gemeinsamen Umwelt zu<br />
verbessern, als dass es um eine theologische Analyse<br />
gehe.<br />
Auch der folgende Beitrag, beigesteuert von Martin<br />
Tamcke, hat die griechisch-orthodoxe Perspektive<br />
zum Thema, jedoch liegt hier der Fokus auf dem Verhältnis<br />
Orthodoxie-Islam vom 7. Jahrh<strong>und</strong>ert bis in<br />
die heutige Zeit. Tamcke stellt das Verhältnis zwischen<br />
Orthodoxie <strong>und</strong> Islam als stets problematisch<br />
dar, da es bereits früh von politischen Elementen<br />
durchdrungen gewesen sei. Anders als Reiss geht<br />
Tamcke davon aus, dass die Anhänger orthodoxer<br />
Kirchen eher im Westen „innerlich beheimatet“ seien<br />
– der Gegensatz in den Ergebnissen dieser beiden lesenswerten<br />
Beiträge wird leider nicht aufgelöst bzw.<br />
nehmen die beiden Autoren keinen Bezug auf den jeweils<br />
<strong>and</strong>eren.<br />
Der dritte <strong>und</strong> letzte Teil des B<strong>and</strong>es versammelt<br />
schließlich drei gänzlich unterschiedliche Perspektiven:<br />
So werden im Beitrag von Gladson Jathaanna<br />
(Göttingen/Mangalore) zunächst die Darstellungen<br />
indischer Frauen in den Berichten schweizerischer<br />
Missionare aus dem 19.Jahrh<strong>und</strong>ert erläutert, bevor<br />
sich Muhammad Sahri al-Dali (Kairo) in einer sehr<br />
präzisen <strong>und</strong> höchst informativen Analyse mit den<br />
Bezeichnungen ausein<strong>and</strong>ersetzt, die in ägyptischen<br />
Quellen vom 16.-19. Jahrh<strong>und</strong>ert für Europäer verwendet<br />
wurden <strong>und</strong> zeichnet die Entwicklungen der<br />
jeweiligen Begriffe nach. Er kommt zu dem nachvollziehbaren<br />
Ergebnis, das die zu beobachtenden Begriffsverschiebungen<br />
auch immer den jeweiligen politischen<br />
Verhältnissen geschuldet seien <strong>und</strong> führt zudem<br />
den Begriff des takfirism in Anlehnung an den<br />
vielzitierten Orientalism ein.<br />
Der abschließende Beitrag von Ramazan Bicer<br />
(Sakarya) steht im Zeichen der Diskussion um das<br />
von muslimischer Seite angenommene Element des<br />
tahrif, also der Abänderungen der Heiligen Schrift,<br />
die Juden <strong>und</strong> Christen vorgenommen haben sollen.<br />
Während diese Diskussion für den jüdischmuslimischen<br />
theologischen Dialog eine wesentliche<br />
Rolle spiele <strong>und</strong> Herausforderung darstelle, sei sie im<br />
christlich-muslimischen Verhältnis von untergeordneter<br />
Bedeutung.<br />
Der vorliegende B<strong>and</strong> eröffnet dem Leser Einblicke<br />
in viele unterschiedliche, bisher weniger berücksichtigte<br />
Details, die mitunter das Verständnis für den<br />
heutigen St<strong>and</strong> der jeweiligen Dialoge zwischen den<br />
Religionen <strong>und</strong> Kulturen erleichtern, da wesentliche<br />
Elemente <strong>und</strong> Faktoren, die diese Dialoge maßgeblich<br />
beeinflussen, aufgezeigt werden. Der thematischen<br />
Vielfalt, die den B<strong>and</strong> auszeichnet, ist konsequenterweise<br />
aber auch der Umst<strong>and</strong> geschuldet, dass die<br />
Beiträge zum großen Teil als Ausgangspunkt für weitere,<br />
eingehendere Beschäftigung mit den jeweiligen<br />
angesprochenen Aspekten des Themenkomplexes<br />
„Kulturbegegnungen“ anzusehen sind.<br />
Katharina Pfannkuch, Leipzig<br />
212<br />
� � �<br />
Wagenhofer, Sophie (2010): „Rassischer“ Feind –<br />
politischer Fre<strong>und</strong>? Inszenierung <strong>und</strong> Instrumentalisierung<br />
des Araberbildes im nationalsozialistischen<br />
Deutschl<strong>and</strong>. – Klaus Schwarz Verlag: Berlin,<br />
132 S.<br />
Der 299. B<strong>and</strong> in der Reihe „Islamk<strong>und</strong>liche Untersuchungen“<br />
ist die von Sophie Wagenhofer 2004 an<br />
der FU Berlin eingereichte Magisterarbeit. Auf 131<br />
Seiten mit 29 zum Großteil schwarz-weißen Abbildungen<br />
minderer Qualität bearbeitet Wagenhofer das<br />
Thema „Rassischer“ Feind – politischer Fre<strong>und</strong>? in<br />
sechs Schritten. Nach einer kurzen Einleitung, in der<br />
sie das Thema zu skizzieren <strong>und</strong> Begriffe zu klären<br />
versucht, diskutiert sie auf viereinhalb Seiten die<br />
„Bedeutung der Propag<strong>and</strong>a im Nationalsozialismus“.<br />
Auf 30 Seiten wird „Der Araber als ``rassischer<br />
Feind´´“ <strong>und</strong> anschließend auf 34 Seiten „Der Araber<br />
als ``politischer Fre<strong>und</strong>´´“ beh<strong>and</strong>elt. Vor dem Fazit<br />
auf fünf Seiten äußert sich Wagenhofer auf 15 Seiten<br />
„Zur Ambivalenz des Araberbildes in Deutschl<strong>and</strong>“.<br />
Die Arbeit schließt mit „Bibliographie <strong>und</strong> Quellen“<br />
auf 12 Seiten.<br />
Klappentext <strong>und</strong> Einleitung versprechen die „oft unterstellte<br />
Affinität der arabischen Welt zum nationalsozialistischen<br />
Deutschl<strong>and</strong> auf ihre reale Substanz<br />
zurück“ zu führen.<br />
Schon in der Einleitung fällt jedoch auf, dass notwendige<br />
Differenzierungen <strong>und</strong> Begriffsklärungen<br />
nicht vorgenommen werden. So wird der Begriff<br />
„Araber“, der im Zentrum dieser Forschungsarbeit<br />
steht, nicht definiert. Weder wird auf historischer<br />
Ebene noch auf der gesellschaftlichen von Bedeutungsverschiebungen<br />
ausgegangen. Es wird auch<br />
nicht thematisiert, wer wann in der nationalsozialistischen<br />
Propag<strong>and</strong>a in welchen Zusammenhängen als<br />
„Araber“ bezeichnet wird.<br />
Wagenhofer argumentiert erstaunlicherweise, obgleich<br />
in den damaligen Medien nicht explizit von<br />
Arabern gesprochen wird, dass die „Araber … Teil<br />
eines übergeordneten Diskurses über afrikanische<br />
Truppen (waren) <strong>und</strong> … nicht explizit als Araber tituliert“<br />
wurden (S. 44). Warum „Farbige“, „Afrikaner“,<br />
„Negerbastarde“, „Schwarze“, „farbige Franzosen“