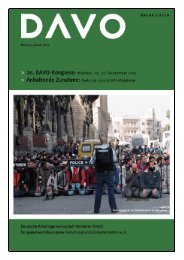4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
schen den Zeilen erfährt man, dass die Frauen auch<br />
im Entwicklungsprojekt selbstbewusst ihre Vorstellungen<br />
<strong>und</strong> Forderungen einbringen, wie diese konkret<br />
aussehen, erfährt man jedoch leider nicht. Bei aller<br />
gebotenen Diskretion hätte man hier doch etwas mehr<br />
erwartet, auch über die Nachbarschafts- <strong>und</strong> Viertelorganisation.<br />
Diese wird auch im Kapitel 7 über die Stadtgemeinschaft<br />
<strong>und</strong> soziale Gliederung nicht ganz deutlich. Dafür<br />
aber schildert Leiermann dort in kurzen Abrissen<br />
allgemeine Sitten <strong>und</strong> Bräuche wie religiöse Gebote,<br />
Moralbegriffe, Gästeempfang <strong>und</strong> Geselligkeit,<br />
Hochzeiten, Sport. Er schildert den Tagesablauf (der<br />
Männer) <strong>und</strong> den rituellen Jahreslauf in Shibam. Diese<br />
impressionistische Darstellung des Stadtlebens<br />
schließt er später im letzten Kapitel „Kleinstadtskizzen“<br />
mit einer Schilderung seiner ganz persönlichen<br />
Eindrücke von seiner Arbeit <strong>und</strong> seinem Leben in der<br />
Stadt ab.<br />
Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Oasenkultur<br />
im Wadi Hadhramaut, mit Bewässerungsanlagen<br />
<strong>und</strong> Wachtürmen. Kapitel 9 beh<strong>and</strong>elt die Moscheen<br />
in <strong>und</strong> um Shibam (leider sind die Pläne nicht<br />
durchgängig mit Nordpfeil <strong>und</strong> Maßstab versehen),<br />
die einen sehr eigenständigen Stil aufweisen, jedoch<br />
auch durch tief in die Substanz eingreifenden Umbau<br />
<strong>und</strong> sogar Abriss bedroht sind.<br />
Im Kapitel 11 „Der Entwicklungsfall“, erläutert<br />
Leiermann das Stadtentwicklungsprojekt der GTZ,<br />
das die Altstadt von Shibam nicht nur als historische<br />
Kulisse, sondern als lebendigen Mikrokosmos seiner<br />
Bewohner betrachtet. Shibam ist heute eine verarmte<br />
ländliche Kleinstadt mit nur geringen wirtschaftlichen<br />
Ressourcen, die es den Einwohnern erschweren, trotz<br />
hoher Identifikation die Bürde des Erhaltes eines<br />
Weltkulturerbes zu tragen. Die eindrückliche Schilderung<br />
der Flutkatastrophe von 2008 zeigt überdies die<br />
Verletzlichkeit der Stadt <strong>und</strong> des komplexen Ökosystems<br />
im Wadi Hadhramaut durch klimatische Bedingungen<br />
<strong>und</strong> die dringend notwendige Sensibilisierung<br />
der Behörden <strong>und</strong> Bewohner für deren Schutz.<br />
Es ist eine lobenswerte Besonderheit des Buches,<br />
dass der Autor seinen Lesern über die f<strong>und</strong>ierte Darstellung<br />
der Architektur hinaus auch das Leben der<br />
Bewohner Shibams nahebringen möchte. Manche<br />
Einschätzungen Leiermanns, etwa über die lokale<br />
Ausprägung des sunnitischen Islams, manche Rituale<br />
oder den F<strong>und</strong>amentalismus, erscheinen jedoch etwas<br />
platt <strong>und</strong> wenig f<strong>und</strong>iert. Ethnologisches <strong>und</strong> islamwissenschaftliches<br />
Hintergr<strong>und</strong>wissen wären wohl<br />
hilfreich gewesen. Dieses Fehlen f<strong>und</strong>ierter wissenschaftlicher<br />
Belege zur Einbettung der eigenen Beobachtungen<br />
<strong>und</strong> Überlegungen macht sich auch in<br />
<strong>and</strong>eren Kapiteln, wie dem geschichtlichen Abriss,<br />
bemerkbar. Der Leser sollte daher stets im Kopf behalten,<br />
dass dem Autor in Shibam die wissenschaftliche<br />
Literatur größtenteils nicht zugänglich war, wie<br />
der Herausgeber dankenswerter Weise in seinem<br />
Vorwort vermerkt.<br />
Leiermanns Plädoyer <strong>und</strong> Engagement für ein umfassendes<br />
Entwicklungsprojekt, das die kulturellen<br />
Aspekte einbezieht (S. 253), ist nicht hoch genug zu<br />
loben. Die oben angemerkten „Schwächen“ des B<strong>and</strong>es<br />
ergeben sich aus der Einzelstellung des Autors in<br />
dem Projekt, dem es nicht zugemutet werden kann,<br />
neben seiner Arbeit als Architekt auch alle übrigen<br />
Aspekte der Stadtkultur wissenschaftlich zu durchdringen.<br />
Vielmehr zeigt die Publikation wieder einmal,<br />
wie wichtig in solchen Projekten die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit zwischen Architekten, Stadtplanern<br />
<strong>und</strong> Ethnologen, Islamwissenschaftlern u.a.<br />
wäre. Gerade der Aspekt der Identität der Bewohner<br />
<strong>und</strong> ihre sehr eigenständige Stadtkultur könnte durch<br />
Einbeziehen ethnologischer Ansätze <strong>und</strong> Methoden<br />
noch besser erfasst <strong>und</strong> nachhaltiger zur Motivierung<br />
der Bewohner im Hinblick auf den Denkmalschutz<br />
eingesetzt werden.<br />
Insgesamt gesehen ist der B<strong>and</strong> eine eigenwillige<br />
Mischung aus wissenschaftlicher Darstellung, persönlichem<br />
Erfahrungsbericht <strong>und</strong> Bildb<strong>and</strong>. Er spiegelt<br />
die allgemeine Literaturlage zum Hadhramaut: Man<br />
ist dankbar, dass ein Anfang gemacht ist <strong>und</strong> hofft,<br />
dass auf dieser Basis weitere Forschung stattfindet.<br />
Das Buch zeigt Möglichkeiten <strong>und</strong> Ansatzpunkte dafür<br />
auf <strong>und</strong> ist somit als Anregung sehr zu empfehlen.<br />
Ulrike Stohrer, Frankfurt am Main<br />
� � �<br />
Ourghi, Mariella (2010): Muslimische Posi<strong>tionen</strong><br />
zur Berechtigung von Gewalt. Einzelstimmen, Revisionen,<br />
Kontroversen. – Ergon: Würzburg, 190 S.<br />
Bereits ein kurzer Blick auf die aktuellen Verlagsangebote<br />
zeigen, dass Veröffentlichungen selbsternannter<br />
Experten, die einem verunsicherten Publikum das<br />
Verhältnis zwischen Islam <strong>und</strong> Terrorismus, Gewalt<br />
<strong>und</strong> Märtyrergedanken erläutern wollen, derzeit<br />
Hochkonjunktur haben. Differenzierte, wissenschaftliche<br />
Untersuchungen wie die von Mariella Ourghi<br />
haben es dagegen schwer, in der Öffentlichkeit Beachtung<br />
zu finden, da sie sich in erster Linie an ein<br />
Fachpublikum richten.<br />
Ourghis Veröffentlichung ist aus dem Teilprojekt<br />
„Islamische Kontroversen über die Berechtigung von<br />
Gewalt“ hervorgegangen, welches Teil des vom<br />
BMBF geförderten Verb<strong>und</strong>projekts „Mobilisierung<br />
von Gewalt in Europa“ war. Im Anschluss an einen<br />
193