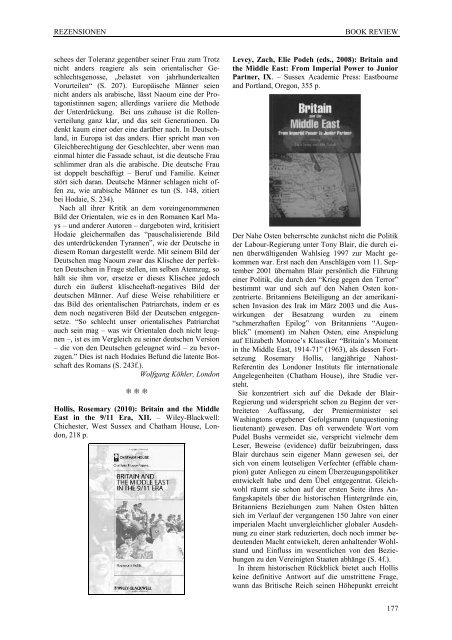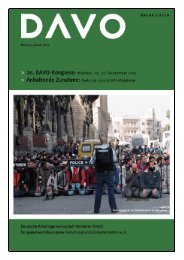4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
schees der Toleranz gegenüber seiner Frau zum Trotz<br />
nicht <strong>and</strong>ers reagiere als sein orientalischer Geschlechtsgenosse,<br />
„belastet von jahrh<strong>und</strong>ertealten<br />
Vorurteilen“ (S. 207). Europäische Männer seien<br />
nicht <strong>and</strong>ers als arabische, lässt Naoum eine der Protagonistinnen<br />
sagen; allerdings variiere die Methode<br />
der Unterdrückung. Bei uns zuhause ist die Rollenverteilung<br />
ganz klar, <strong>und</strong> das seit Genera<strong>tionen</strong>. Da<br />
denkt kaum einer oder eine darüber nach. In Deutschl<strong>and</strong>,<br />
in Europa ist das <strong>and</strong>ers. Hier spricht man von<br />
Gleichberechtigung der Geschlechter, aber wenn man<br />
einmal hinter die Fassade schaut, ist die deutsche Frau<br />
schlimmer dran als die arabische. Die deutsche Frau<br />
ist doppelt beschäftigt – Beruf <strong>und</strong> Familie. Keiner<br />
stört sich daran. Deutsche Männer schlagen nicht offen<br />
zu, wie arabische Männer es tun (S. 148, zitiert<br />
bei Hodaie, S. 234).<br />
Nach all ihrer Kritik an dem voreingenommenen<br />
Bild der Orientalen, wie es in den Romanen Karl Mays<br />
– <strong>und</strong> <strong>and</strong>erer Autoren – dargeboten wird, kritisiert<br />
Hodaie gleichermaßen das “pauschalisierende Bild<br />
des unterdrückenden Tyrannen”, wie der Deutsche in<br />
diesem Roman dargestellt werde. Mit seinem Bild der<br />
Deutschen mag Naoum zwar das Klischee der perfekten<br />
Deutschen in Frage stellen, im selben Atemzug, so<br />
hält sie ihm vor, ersetze er dieses Klischee jedoch<br />
durch ein äußerst klischeehaft-negatives Bild der<br />
deutschen Männer. Auf diese Weise rehabilitiere er<br />
das Bild des orientalischen Patriarchats, indem er es<br />
dem noch negativeren Bild der Deutschen entgegensetze.<br />
“So schlecht unser orientalisches Patriarchat<br />
auch sein mag – was wir Orientalen doch nicht leugnen<br />
–, ist es im Vergleich zu seiner deutschen Version<br />
– die von den Deutschen geleugnet wird – zu bevorzugen.”<br />
Dies ist nach Hodaies Bef<strong>und</strong> die latente Botschaft<br />
des Romans (S. 243f.).<br />
Wolfgang Köhler, London<br />
� � �<br />
Hollis, Rosemary (2010): Britain <strong>and</strong> the Middle<br />
East in the 9/11 Era, XII. – Wiley-Blackwell:<br />
Chichester, West Sussex <strong>and</strong> Chatham House, London,<br />
218 p.<br />
Levey, Zach, Elie Podeh (eds., 2008): Britain <strong>and</strong><br />
the Middle East: From Imperial Power to Junior<br />
Partner, IX. – Sussex Academic Press: Eastbourne<br />
<strong>and</strong> Portl<strong>and</strong>, Oregon, 355 p.<br />
Der Nahe Osten beherrschte zunächst nicht die Politik<br />
der Labour-Regierung unter Tony Blair, die durch einen<br />
überwältigenden Wahlsieg 1997 zur Macht gekommen<br />
war. Erst nach den Anschlägen vom 11. September<br />
2001 übernahm Blair persönlich die Führung<br />
einer Politik, die durch den “Krieg gegen den Terror”<br />
bestimmt war <strong>und</strong> sich auf den Nahen Osten konzentrierte.<br />
Britanniens Beteiligung an der amerikanischen<br />
Invasion des Irak im März 2003 <strong>und</strong> die Auswirkungen<br />
der Besatzung wurden zu einem<br />
“schmerzhaften Epilog” von Britanniens “Augenblick”<br />
(moment) im Nahen Osten, eine Anspielung<br />
auf Elizabeth Monroe’s Klassiker “Britain’s Moment<br />
in the Middle East, 1914-71” (1963), als dessen Fortsetzung<br />
Rosemary Hollis, langjährige Nahost-<br />
Referentin des Londoner Instituts für internationale<br />
Angelegenheiten (Chatham House), ihre Studie versteht.<br />
Sie konzentriert sich auf die Dekade der Blair-<br />
Regierung <strong>und</strong> widerspricht schon zu Beginn der verbreiteten<br />
Auffassung, der Premierminister sei<br />
Washingtons ergebener Gefolgsmann (unquestioning<br />
lieutenant) gewesen. Das oft verwendete Wort vom<br />
Pudel Bushs vermeidet sie, verspricht vielmehr dem<br />
Leser, Beweise (evidence) dafür beizubringen, dass<br />
Blair durchaus sein eigener Mann gewesen sei, der<br />
sich von einem leutseligen Verfechter (effable champion)<br />
guter Anliegen zu einem Überzeugungspolitiker<br />
entwickelt habe <strong>und</strong> dem Übel entgegentrat. Gleichwohl<br />
räumt sie schon auf der ersten Seite ihres Anfangskapitels<br />
über die historischen Hintergründe ein,<br />
Britanniens Beziehungen zum Nahen Osten hätten<br />
sich im Verlauf der vergangenen 150 Jahre von einer<br />
imperialen Macht unvergleichlicher globaler Ausdehnung<br />
zu einer stark reduzierten, doch noch immer bedeutenden<br />
Macht entwickelt, deren anhaltender Wohlst<strong>and</strong><br />
<strong>und</strong> Einfluss im wesentlichen von den Beziehungen<br />
zu den Vereinigten Staaten abhänge (S. 4f.).<br />
In ihrem historischen Rückblick bietet auch Hollis<br />
keine definitive Antwort auf die umstrittene Frage,<br />
wann das Britische Reich seinen Höhepunkt erreicht<br />
177