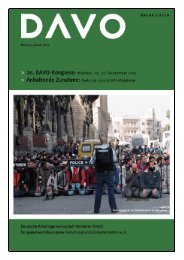4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
Holthaus, Leonie (2010): Regimelegitimität <strong>und</strong><br />
regionale Kooperation im Golf-Kooperationsrat<br />
(Gulf Cooperation Council). – Peter Lang: Frankfurt/Main,<br />
111 S.<br />
Der Golfkooperationsrat (GKR) ist wohl die wichtigste<br />
subregionale Organisation im Vorderen Orient.<br />
Dennoch lässt die politikwissenschaftliche Beschäftigung<br />
mit diesem Thema im deutschsprachigen Bereich<br />
bislang zu wünschen übrig. Die Monographie<br />
von Leonie Holthaus ist somit schon aufgr<strong>und</strong> ihres<br />
Pioniercharakters zu würdigen. Ihre These, nämlich<br />
dass der GKR hauptsächlich der Verteidigung der<br />
monarchischen Herrschaftsform dient, findet sich gerade<br />
angesichts der aktuellen Entwicklungen bestätigt,<br />
da Jordanien <strong>und</strong> Marokko durch Beitrittsgesuche in<br />
Zeiten regionaler Umwälzungen vor allem auf finanziellen<br />
Beist<strong>and</strong> durch die Golfstaaten hoffen.<br />
Holthaus geht in ihrem höchst relevanten Buch der<br />
Frage nach, wie externe Regimelegitimität <strong>und</strong> regionale<br />
Kooperation im Rahmen des GKR zusammenhängen.<br />
Mit ihrer Arbeit knüpft die Autorin sowohl an<br />
die Neuere Autoritarismusforschung innerhalb der<br />
Vergleichenden Politikwissenschaft als auch an Literatur<br />
aus den Internationalen Beziehungen an.<br />
In ihrem theoretischen Teil stellt sie in Kapitel 2 zunächst<br />
den Ansatz des Sozialkonstruktivismus vor,<br />
der die normative Dimension des Legitimitätsbegriffs<br />
integrieren soll. In Kapitel 3 erfolgen Überlegungen<br />
zur theoretischen Erfassung von Legitimität, wobei<br />
Holthaus diesen Begriff auf der nationalen, regionalen<br />
<strong>und</strong> internationalen Ebene verwendet. Der Autorin<br />
kommt also einerseits das Verdienst zu, Legitimität<br />
um eine externe Dimension zu ergänzen. Sehr hervorzuheben<br />
ist aber <strong>and</strong>ererseits, dass sie von mehr als<br />
einer Art der externen Legitimität spricht, da bei unterschiedlichen<br />
internationalen Akteuren aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
unterschiedlichen Normen eine „Vielzahl von divergierenden<br />
Einschätzungen externer Legitimität<br />
existieren“ (S. 27). Holthaus arbeitet einige Wechselwirkungen<br />
zwischen Legitimität auf der innerstaatlichen<br />
<strong>und</strong> der internationalen Ebene heraus, wobei ihr<br />
zufolge hauptsächlich externe Faktoren Einfluss auf<br />
die interne Legitimität ausüben. Allenfalls eine Unterscheidung<br />
von Legitimität als Zust<strong>and</strong> <strong>und</strong> Legitimierung<br />
als Prozess, um diesen Zust<strong>and</strong> zu erreichen, ist<br />
zu vermissen.<br />
Was die Definition des zentralen Konzepts der externen<br />
Legitimität angeht, so ist jedoch deren Uneindeutigkeit<br />
zu beklagen, denn es „wird die externe Legitimität<br />
eines politischen Systems oder einer/s spezifischen<br />
Regierung/Regimes als abhängig von den<br />
Werten <strong>und</strong> Normen des relevanten externen Akteurs<br />
betrachtet. Externe Legitimitätsurteile können sich auf<br />
die politische Ordnung oder das H<strong>and</strong>eln der Regierung/des<br />
Regimes auf der nationalen wie internationalen<br />
Ebene beziehen“ (S. 27). Warum Holthaus nicht<br />
genauer bestimmt, ob Legitimität sich auf das politische<br />
System, eine Regierung oder ein Regime beziehen<br />
soll, ist schon angesichts des Buchtitels („Regimelegitimität…“)<br />
nicht ersichtlich. Klarere Begrifflichkeiten<br />
hätten die folgende Analyse stringenter<br />
vorstrukturiert.<br />
186<br />
Holthaus begründet in Kapitel 4 die Logik der<br />
GKR-Gründung mit dem Legitimitätsverlust der monarchischen<br />
Golfstaaten nach der Islamischen Revolution<br />
in Iran 1979 <strong>und</strong> lehnt somit eine Interpretation<br />
des Zusammenschlusses aufgr<strong>und</strong> kultureller Gemeinsamkeiten<br />
<strong>und</strong> einer „historischen Allianz“ als<br />
„Konstruktion der achtziger Jahre“ ebenso ab wie einen<br />
neorealistischen Erklärungsansatz (S. 42). Dies<br />
wird in Kapitel 5 fortgeführt mit einer Betrachtung<br />
des Widerspruches von panarabischen <strong>und</strong> GKRspezifischen<br />
Argumenten. Interessant ist hierbei das<br />
„Spannungsverhältnis zwischen Referenzen auf den<br />
arabischen Einheitsgedanken <strong>und</strong> der Begründung der<br />
‚besonderen Beziehungen‘ unter den arabischen<br />
Golfstaaten“ (S. 43), die <strong>and</strong>ere arabische Staaten<br />
ausschließen.<br />
In Kapitel 6 wird die regionale Kooperation seit<br />
Gründung des GKR anh<strong>and</strong> der Bereiche Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Sicherheit untersucht. Diese Bereiche der Kooperation<br />
befähigen die Regierungen im Golf vor allem,<br />
materielle Legitimationsgewinne zu verbuchen. Allerdings<br />
stehen interne Legitimität <strong>und</strong> regionale Kooperation<br />
in einem Spannungsverhältnis, da „primär<br />
die Strategien, die intern die Stabilität <strong>und</strong> Legitimität<br />
der herrschenden Regime wahren … auf (sub-) regionaler<br />
Ebene die wirtschaftliche Integration unterlaufen“<br />
(S. 70).<br />
Das vorletzte Kapitel zu den Beziehungen des GCC<br />
mit der Europäischen Union soll herausarbeiten, ob<br />
die regionale Kooperation die externe Legitimität in<br />
den Augen der EU erhöht. Eines der Ergebnisse lautet<br />
jedoch, dass sich einzelne Staaten der EU gegenüber<br />
durch Vermittlungsversuche in <strong>and</strong>eren Konflikten als<br />
„Stabilitätsfaktoren“ innerhalb der Region präsentieren<br />
(S. 90). Gerade der Faktor der Kooperation hat<br />
hierbei keinen Einfluss auf die von der EU ausgehende<br />
externe Legitimität. An dieser Stelle lässt die analytische<br />
Schärfe nach, wenn Vermittlungsversuche<br />
der einzelnen Staaten durch die EU positiv als Beweis<br />
für den Erfolg des GKR gewertet werden <strong>und</strong> darum<br />
dann keine Unterscheidung mehr zwischen den Aktivitäten<br />
der GKR-Staaten <strong>und</strong> der Organisation selbst<br />
getroffen wird.<br />
Auffällig ist, dass im Rahmen der Analyse von Vertragsdokumenten<br />
häufig offiziellen Stimmen gefolgt<br />
wird, ohne dass dies empirisch nachweisbar wäre.<br />
Dies ist auch dort der Fall, wo skeptische Wissenschaftler<br />
eine abweichende Einschätzung vornehmen<br />
(z.B. S. 61; 86-89). Der Lesefluss leidet etwas durch<br />
die in Fließtext <strong>und</strong> Fußnoten jeweils unterschiedliche<br />
Zitierweise; leider fehlen in den Fußnoten die Jahresangaben<br />
der verwendeten Literatur. Stilistisch ist vor<br />
allem der großzügige Gebrauch von Anglizismen zu<br />
bemängeln, die teils zu holprigem Deutsch <strong>und</strong> false<br />
friends führen (z.B. Tarif statt Zoll, S. 70).<br />
Überzeugend beschreibt die Autorin die institutionelle<br />
Ausprägung des GKR, der einen Kooperationsrahmen<br />
ohne die geringste Aufgabe nationaler Souveränität<br />
darstellt (<strong>und</strong> daher auch nicht supranational<br />
ist, wie mancherorts zu lesen ist) <strong>und</strong> in dem vorwiegend<br />
die autoritären Monarchien durch ihre wechselseitige<br />
Anerkennung ihre Herrschaftsform bestätigen.