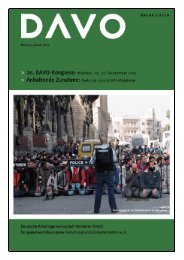4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DISSERTATIONEN DISSERTATIONS<br />
vermochten, erscheint es in den untersuchten Artikeln<br />
der Zeitungen al-Hayat, Asharq Alawsat sowie al-<br />
Quds al-Arabi zumeist als unfähig, sich aus den postkolonialen<br />
Strukturen zu befreien. Auf diese Weisen<br />
wird eine scheinbar ausweglose Krise der Gegenwart<br />
gezeichnet – die jenseits des Weltbildes vom „Kampf<br />
der Kulturen“ á la Samuel Huntington liegt.<br />
Die hier herausgearbeiteten imaginativen Geographien<br />
liefern <strong>and</strong>ere Lesarten des politischen Geschehens<br />
als Huntington, sie (re)produzieren <strong>and</strong>ere Gesellschaftsverhält-nisse<br />
<strong>und</strong> rütteln damit an den F<strong>und</strong>amenten<br />
des Euro- <strong>und</strong> Westzentrismus, der<br />
Huntingtons Weltbild eingeschrieben ist. Jedoch dürfen<br />
sie nicht als „besser“ verst<strong>and</strong>en werden. Ebenso<br />
wie das Szenario vom „Kampf der Kulturen“ bringen<br />
sie als Konstruk<strong>tionen</strong> massenmedialer Diskurse der<br />
Bereiche Nachrichten, Berichterstattung <strong>und</strong> Meinung<br />
Negativität zum Ausdruck <strong>und</strong> simplifizieren, stereotypisieren<br />
<strong>und</strong> naturalisieren in starkem Maße. Daher<br />
ist es im Sinne eines poststrukturalistischen Ansatzes<br />
nun wichtig, auch diese imaginativen Geographien<br />
wieder aufzubrechen <strong>und</strong> nach Alternativen zu suchen.<br />
Für zukünftige Forschungsarbeiten, die an die vorliegende<br />
Studie anschließen, bedeutet dies v.a. zweierlei:<br />
Da hier der Fokus auf transnationale arabische Printmedien<br />
gelegt <strong>und</strong> ein Zeit-raum zwischen den Jahren<br />
2001 <strong>und</strong> 2006 analysiert wurde, wäre zunächst wichtig<br />
zu fragen, in welchen Öffentlichkeitsdiskursen <strong>und</strong><br />
zu welcher Zeit die krisenhafte <strong>und</strong> ausweglose<br />
(Post)Kolonialität außerdem (re)produziert wird.<br />
In welchen Medien <strong>und</strong> Foren <strong>und</strong> zu welchen Zeitpunkten<br />
erscheint sie als hegemonial? Zum Zweiten –<br />
<strong>und</strong> dies ist sehr viel wesentlicher – muss das Widerst<strong>and</strong>spotenzial<br />
aufgespürt werden, <strong>und</strong> zwar in Form<br />
eines Wider-st<strong>and</strong>s, der dem Eigenen Macht <strong>und</strong><br />
H<strong>and</strong>lungsmöglichkeiten im politischen Geschehen<br />
zuschreibt. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der politischen Umbrüche<br />
in den arabischen Staaten, die Ende des Jahres<br />
2010 einsetzten, gilt dies umso mehr. In welchen<br />
diskursiven Zusammenhängen zeigt sich der Widerst<strong>and</strong>,<br />
bricht aus den scheinbar ausweglosen<br />
(post)kolonialen Strukturen aus <strong>und</strong> sorgt für tiefer<br />
greifende Veränderungen, um nicht auf der Ebene des<br />
Vorwurfs <strong>und</strong> der Schuldzuweisung an die so genannten<br />
(post)kolonialen Aggressoren <strong>und</strong> Regime zu<br />
verweilen?<br />
� � �<br />
Jasmin Khosravie: Zabān-i Zanān – Die Stimme<br />
der Frauen. Leben <strong>und</strong> Werk von Ṣadīqa Daulatābādī<br />
(1882–1961). – Abgeschlossene Dissertation<br />
am Institut für Orient- <strong>und</strong> Asienwissenschaften (Abt.<br />
Islamwissenschaft), Rheinische Friedrich-Wilhelms-<br />
Universität Bonn. Betreuer: Prof. Dr. Birgitt Hoffmann<br />
<strong>und</strong> Prof. Dr. Stephan Conermann.<br />
Die Publizistin, Bildungsaktivistin <strong>und</strong> Feministin<br />
Ṣadīqa Daulatābādī (1882–1961) gilt als eine der<br />
bedeutendsten Figuren der frühen iranischen Frauenbewegung.<br />
Sie wurde Zeitzeugin tiefgreifender politi-<br />
scher <strong>und</strong> gesellschaftlicher Umbrüche, die sie aktiv<br />
verfolgte, mitgestaltete <strong>und</strong> öffentlich kommentierte.<br />
Engagiert arbeitete sie in unterschiedlichen Frauengesellschaften,<br />
gründete Mädchenschulen <strong>und</strong> setzte sich<br />
Zeit ihres Lebens gegen die soziale, rechtliche <strong>und</strong><br />
politische Benachteiligung von Frauen ein. Bekannt<br />
wurde Ṣadīqa Daulatābādī vor allem durch ihre erstmals<br />
1919 in Isfahan publizierte Frauenzeitung<br />
Zabān-i Zanān („Die Stimme der Frauen“), die gesellschaftliche<br />
<strong>und</strong> politische Missstände tabulos thematisierte.<br />
Zabān-i Zanān war nach zwei Teheraner Publika<strong>tionen</strong><br />
die erste Frauenzeitung außerhalb der Hauptstadt<br />
<strong>und</strong> unterschied sich vor allem durch ihre kontroverse<br />
Haltung, die neben lobender Zustimmung<br />
auch heftigen Widerst<strong>and</strong> hervorrief. Die resolute<br />
Daulatābādī ließ sich aber weder von ihren Kritikern<br />
noch von gewaltsamen Attacken <strong>und</strong> einem zwischenzeitlichen<br />
Publikationsverbot einschüchtern, <strong>und</strong> setzte<br />
ihre Arbeit fort.<br />
Erst mit ihrer Reise nach Europa 1923 stellt sie<br />
Zabān-i Zanān vorerst ein. Während ihrer vier Jahre<br />
im Ausl<strong>and</strong> lebt Ṣadīqa Daulatābādī kurzzeitig in der<br />
Schweiz <strong>und</strong> in Deutschl<strong>and</strong>, bevor sie nach Paris geht<br />
<strong>und</strong> ein Studium beginnt. Als dort 1926 der Frauenkongress<br />
der International Woman Suffrage Alliance<br />
stattfindet, nimmt sie als offizielle Repräsentantin<br />
Irans teil, spricht zu den versammelten Feministinnen<br />
<strong>und</strong> etabliert neue Kontakte. Mit einem Pädagogik-<br />
Diplom der Sorbonne im Gepäck kehrt sie ein Jahr<br />
später nach Teheran zurück <strong>und</strong> beginnt unter Riżā<br />
Šāh Pahlavī (reg. 1925-41) eine Karriere im Bildungsministerium<br />
als Verantwortliche für Mädchenschulen.<br />
Mitte der 1930er Jahre wird Ṣadīqa Daulatābādī an<br />
die Spitze der staatsfeministischen Einrichtung<br />
Kānūn-i Bānuvān („Club der Frauen“) berufen <strong>und</strong><br />
trägt mit dieser Organisation durch Bildungsinitiativen<br />
<strong>und</strong> Vorträge dazu bei, die modernistische Vision des<br />
Pahlavi-Regimes zu verbreiten. Kānūn-i Bānuvān<br />
spielte insbesondere in der Vorbereitung auf die<br />
Zwangsentschleierung von 1936 eine maßgebliche<br />
Rolle. Nach der Abdankung des Schahs 1941 publiziert<br />
Ṣadīqa Daulatābādī erneut Zabān-i Zanān in<br />
einem neuen politischen Klima. Angesichts neu auf-<br />
111