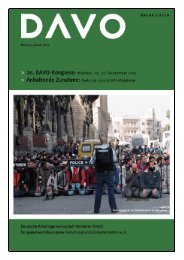4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
reiche Gemeinschaft der Drusen, die je nach St<strong>and</strong><br />
punkt der extremen Schia zuzurechnen, oder als eigenständige<br />
Religion zu werten ist. Allein die Gruppe<br />
der Christen umfasst zwölf verschiedene Denomina<strong>tionen</strong>.<br />
Dass der konfessionelle Hintergr<strong>und</strong> für viele<br />
Libanesen einen entscheidenden Teil persönlicher<br />
Identität darstellt, dürfte unstrittig sein, ebenso wie<br />
die Tatsache, dass konfessionelle Zugehörigkeit zumeist<br />
zum bestimmenden Moment politischer Orientierung<br />
wird. Die Undurchlässigkeit konfessionell bestimmter<br />
Grenzziehung im Libanon ist unschwer auszumachen,<br />
wenn man die politische (Konfessionenproporz<br />
<strong>und</strong> streng konfessionalistische Parteienl<strong>and</strong>schaft)<br />
<strong>und</strong> die soziale Ebene (zumeist räumliche<br />
Trennung der Bevölkerung nach konfessionellem<br />
Muster, wenige konfessionelle Mischehen usw.) betrachtet<br />
(vgl. von Angern: 17f.). Diese Umstände lassen<br />
vermuten, dass auch das Verständnis von Geschichte<br />
im Libanon in hohem Maße kontextabhängig<br />
ist – <strong>und</strong> zwar vom Kontext der jeweiligen konfessionellen<br />
Gruppe.<br />
Konfession, konfessionelle Strukturen <strong>und</strong> geschichtliche<br />
Entwicklung sind bereits vielfach zum<br />
Gegenst<strong>and</strong> der Forschung über den Libanon geworden.<br />
Von Angerns Ansatz aber ist insofern neu <strong>und</strong><br />
innovativ, als er sich dem Gegenst<strong>and</strong>sbereich Konfession<br />
<strong>und</strong> Geschichte im Libanon mittels der erinnerungskulturwissenschaftlichen<br />
Analyse nähert. Der<br />
Autor will nicht einen weiteren Versuch geschichtswissenschaftlicher<br />
Analyse des Libanon, bzw. der<br />
Entwicklung seiner konfessionellen Gruppen ‚von außen‘<br />
anstellen. Er richtet seinen Blick vielmehr auf<br />
die subjektiven, individuellen geschichtlichen Topoi,<br />
die sich, so seine Annahme, konfessionell bedingt<br />
strikt unterscheiden <strong>und</strong> auf der Metaebene als kollektive<br />
Identitäten erkennbar werden. Diese kollektiven<br />
Identitäten ‚herauszupräparieren‘ <strong>und</strong> vergleichend<br />
gegenüberzustellen, hat sich von Angern zum Ziel<br />
gemacht. Zu diesem Zweck hat er insgesamt r<strong>und</strong><br />
fünfzig verschiedene Personen aus dem Kreis der verschiedenen<br />
Konfessionen des Libanon einer ausführlichen<br />
Befragung unterzogen (16 Maroniten, 7 Orthodoxe,<br />
10 Sunniten, 11 Schiiten <strong>und</strong> 10 Drusen). Innerhalb<br />
des jeweiligen konfessionellen Samples hat er<br />
sich um eine möglichst breite gesellschaftliche Streuung<br />
der Informanten bemüht.<br />
162<br />
Die Darstellung der verschiedenen Geschichtskonstrukte<br />
auf Basis der Befragungen <strong>und</strong> die darauf folgende<br />
Analyse nimmt den mit Abst<strong>and</strong> größten Teil<br />
der Arbeit ein. Dieser vorangestellt ist ein geschichtswissenschaftlicher<br />
Einführungsteil, der als<br />
‚Prüfstein‘ für die narrativen Konstrukte dienen soll.<br />
Von Angern gelingt es dank seiner feldforscherischen<br />
Anstrengungen, die in dieser Form durchaus als Pionierarbeit<br />
verst<strong>and</strong>en werden dürfen, einige sehr interessante<br />
Aspekte konfessionell bedingter libanesischer<br />
Identität herauszuarbeiten. Die befragten Maroniten<br />
hielten in der Mehrheit immer noch die Idee einer<br />
phönizischen Nachkommenschaft (<strong>und</strong> zwar<br />
durchaus auch im ethnischen Sinne) als Antithese zur<br />
arabischen Identität hoch <strong>und</strong> unterschieden sich damit<br />
diametral zur Gruppe aller Befragten Sunniten,<br />
die dem Phönizianismus für die eigene Identität keinerlei<br />
Bedeutung zumaßen. Besonders interessant ist<br />
die massive Spaltung innerhalb des sunnitischen<br />
Samples zwischen unversöhnlichen Extremisten, die<br />
einen religiös begründeten Hegemonialanspruch zu<br />
erkennen geben <strong>und</strong> den ‚Gemäßigten‘, die einen<br />
W<strong>and</strong>el vom Pan arabismus zum libanesischen Patriotismus<br />
durchgemacht <strong>und</strong> sich somit den <strong>and</strong>eren<br />
Konfessionsgruppen angenähert haben.<br />
Insgesamt h<strong>and</strong>elt es sich um eine sehr innovative<br />
<strong>und</strong> interessante Arbeit, die sich in brisantes Terrain<br />
vorwagt <strong>und</strong> durch einen klaren <strong>und</strong> prägnanten<br />
Schreibstil auffällt. Einige Wermutstropfen bleiben<br />
dennoch. So wirken einige Best<strong>and</strong>teile kollektiver<br />
Identitäten in der Analyse etwas holzschnittartig,<br />
wenn es heißt, Maroniten würden sich als ‚fleißiges<br />
Bergvolk‘, Schiiten als ‚selbstbewusst‘ <strong>und</strong> ‚vernunftorientiert‘<br />
begreifen. Problematisch ist auch,<br />
dass zahlenmäßige Verzerrungen der Samplegruppen,<br />
die eigentlich die konfessionell-demographischen Gegebenheiten<br />
des Libanon abbilden sollen, normativ<br />
begründet werden (z.B. Gleichgewicht zwischen<br />
Christen <strong>und</strong> Muslimen in den Samples, da dies dem<br />
Verständnis des libanesischen Staates entspreche<br />
usw.). Zu guter Letzt leidet die Verallgemeinerbarkeit<br />
der Erkenntnisse unter der sehr geringen Fallzahl<br />
der Befragten, wobei dem Autor zugute gehalten werden<br />
muss, dass eine qualitative Befragung größerer<br />
Samplegruppen für eine Person kaum zu bewältigen<br />
wäre.<br />
Niklas Hünseler, Mainz<br />
� � �<br />
Bayraktar, Hatice (2010): „Zweideutige Individuen<br />
in schlechter Absicht“. Die antisemitischen Ausschreitungen<br />
in Thrakien 1934 <strong>und</strong> ihre Hintergründe.<br />
– Schwarz: Berlin, 281S.<br />
Es ist immer wohltuend, wenn ein <strong>Dissertations</strong>projekt<br />
einerseits a) inhaltlich begrenzt, b) nicht noch ein<br />
weiterer Beitrag zu einem der teilweise über die Maßen<br />
bemühten Mainstream-Themen eines Faches ist,<br />
<strong>and</strong>ererseits das Thema, die antisemitischen Übergriffe<br />
in der kemalistischen Türkei, vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
der türkisch-israelischen Irrita<strong>tionen</strong> einen aktuellen<br />
Bezug hat <strong>und</strong> letztendlich aufgr<strong>und</strong> einer überaus