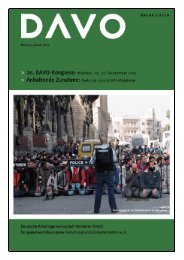4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
schaft <strong>und</strong> verhindere eine Erstarrung des gelebten<br />
Glaubens. Durch permanente ijtihad <strong>und</strong> rationale Reflexion<br />
überschreite sich die religiöse Person permanent<br />
selbst, entwickele ihren eigenen Glauben weiter<br />
<strong>und</strong> trage die ethische Gr<strong>und</strong>lage für gemeinschaftlichen<br />
humanen Fortschritt in sich.<br />
Die übersetzt vorliegenden Essays über den Menschen<br />
veranschaulichen die von Lahbabi favorisierte<br />
diskursive Koranauslegung im Sinne von Menschlichkeit.<br />
Sie stützen sich auf die göttliche Güte<br />
(rahma) <strong>und</strong> postulieren eine göttliche Garantie für<br />
die Menschenrechte. Trotz aller Erfahrungen des Bösen,<br />
der Schuld, der Angst <strong>und</strong> nicht zuletzt der Erniedrigung<br />
durch Dritte (z.B. im Kolonialismus, aber<br />
auch in den postkolonialen Regimen der Arabischen<br />
Welt) verheißt Lahbabis an den Salafiten orientierter<br />
islamischer Rationalismus eine Zukunft, in der Gottesliebe<br />
<strong>und</strong> Menschenliebe eine Einheit bilden. Die<br />
Aussicht auf diese Zukunft bedeutet demnach nicht<br />
nur für das einzelne Individuum eine hoffnungsvolle<br />
Perspektive, sondern darüber hinaus für die menschliche<br />
Gemeinschaft insgesamt. Lahbabi versteht sie als<br />
Gr<strong>und</strong>lage einer freiheitlichen, jedoch nicht wertfreien<br />
Gesellschaft, die sich immer wieder im Sinne ihrer<br />
kollektiven Freiheit engagiere <strong>und</strong> die Basis einer<br />
humanen Weltordnung bilde, in der ein jeder den <strong>and</strong>eren<br />
als freies emanzipiertes gleichrangiges Mitglied<br />
achte.<br />
Lahbabis Personalismus tritt an die westliche Zivilisation<br />
heran <strong>und</strong> fordert sie auf, sich von dem Superiorismus,<br />
der für den Kolonialismus die geistige Voraussetzung<br />
schuf, ebenso zu befreien wie von einer<br />
Unterwerfungsmentalität, die Diktaturen gleichermaßen<br />
den Aktionsradius erweitert wie menschenfeindlichen<br />
multinationalen Konzernen <strong>und</strong> Kapitalgesellschaften.<br />
Gerade in Deutschl<strong>and</strong>, wo eine auf Superiorismus<br />
basierende Ideologie einhergehend mit der<br />
Deklarierung von Nichtdeutschen bzw. „Nichtarierern“<br />
als „minderwertig“ in der Historie sich in einem<br />
Welteroberungs- <strong>und</strong> Weltbeherrschungswahn ausgedrückt<br />
hat <strong>und</strong> im institutionalisierten Massenmord<br />
ihren Höhepunkt f<strong>and</strong>, kann Lahbabis vernunftgeleiteter,<br />
an die gesamte Menschheit gerichteter Personalismus<br />
einen Denkprozess initiieren, der jeglichem<br />
kollektiven Überheblichkeitsbewusstsein entgegenwirkt.<br />
Mohammed Khallouk, Marburg<br />
192<br />
� � �<br />
Leiermann, Tom (2009): Shibam – Leben in<br />
Lehmtürmen. Weltkulturerbe im Jemen. - Dr.<br />
Ludwig Reichert Verlag: Wiesbaden, 284 S.<br />
Eine Publikation zur berühmten Stadt Shibam im<br />
Wadi Hadhramaut/Jemen ist schon lange ein Desiderat<br />
für alle an der Lehmarchitektur Südarabiens Interessierten.<br />
Bereits seit 1984 steht Shibam auf der<br />
Weltkulturerbeliste der UNESCO. Nun liegt erstmals<br />
eine umfassende Best<strong>and</strong>saufnahme der Stadtarchitektur<br />
Shibams vor. Der Autor Tom Leiermann arbeitet<br />
als Architekt im Deutsch-Jemenitischen Stadtenticklungsprojekt<br />
Shibam der GTZ. Aus dieser Tätig-<br />
keit heraus beschreibt er in zwölf Kapiteln die Geschichte,<br />
die funktionale Gliederung, die Wohnhäuser,<br />
die Moscheen <strong>und</strong> das tägliche Leben der Bewohner<br />
der Altstadt von Shibam. Karten, Gr<strong>und</strong>risse,<br />
Pläne, Skizzen, ein Glossar sowie zahlreiche Photos<br />
in hervorragender Druckqualität ergänzen den Text.<br />
Nach einer allgemeinen Einführung verfolgt ein geschichtlicher<br />
Abriss zunächst die Ursprünge der<br />
Stadtanlage <strong>und</strong> der Hochhausarchitektur Shibams bis<br />
in die antiken Hochkulturen Südarabiens zurück. Leiermann<br />
erklärt ihre bemerkenswerte Kontinuität mit<br />
der Jahrh<strong>und</strong>erte langen Isolation des Hadhramaut,<br />
wobei er aber auch auf die interessanten Parallelen zur<br />
Architektur Äthiopiens eingeht. Die folgenden Kapitel<br />
widmen sich der funktionalen Gliederung der<br />
Stadt, dem Lehmbau <strong>und</strong> den Wohnhäusern. Detailliert<br />
werden die Lehmbautechnik <strong>und</strong> die Konstruktionsprinzipien<br />
der Häuser erläutert <strong>und</strong> die einzelnen<br />
Arbeitsgänge mit vielen Photos illustriert.<br />
Leider fehlen weitgehend Hinweise zur Raumnutzung<br />
<strong>und</strong> Wertigkeit der einzelnen Bereiche des Hauses,<br />
etwa nach dem Verhältnis zwischen Arbeits- <strong>und</strong><br />
Repräsentationsbereichen, weiblicher <strong>und</strong> männlicher<br />
Sphäre u.ä.. Gerade im Vergleich mit der Hochhausarchitektur<br />
<strong>and</strong>erer jemenitischer Städte wie Sanaa<br />
oder Sa c dah mit ihrer ausgeprägten Raumhierarchie<br />
stellt sich die Frage, wie diese im Hadhramaut gelöst<br />
wird. Stattdessen findet man an dieser Stelle (S. 112-<br />
120) ein Glossar der Architekturteile, das zwar hohen<br />
dokumentarischen Wert hat, es dem Leser aber doch<br />
etwas erschwert, sich die Einrichtung, Funktion <strong>und</strong><br />
Lebensweise in den Häusern vorzustellen. Leiermann<br />
ist durch seine einheimische Ehefrau stärker in die<br />
Gesellschaft der Stadt integriert, als es westliche Entwicklungshelfer<br />
gemeinhin sind. Er hätte so einen besonderen<br />
Zugang zu den indigenen Auffassungen <strong>und</strong><br />
Konzepten der Bewohner zu ihrer Architektur <strong>und</strong><br />
Lebensweise.<br />
Der Abschnitt „Genus“ über die Geschlechterbeziehungen<br />
in Shibam fällt jedoch merkwürdig verhalten<br />
<strong>und</strong> distanziert aus <strong>und</strong> gibt über allgemein bekannte<br />
Vorstellungen im Islam über die hohe Bedeutung der<br />
Familie oder den Ehevertrag keine konkreten Informa<strong>tionen</strong><br />
über das Leben <strong>und</strong> das Selbstverständnis<br />
der Frauen in Shibam. Dies wäre jedoch wichtig, da ja<br />
das Haus „die“ weibliche Sphäre schlechthin ist. Zwi-