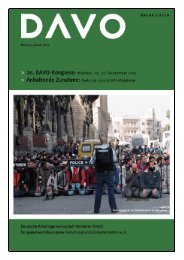4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
VORTRÄGE 18. DAVO-KONGRESS PAPERS DAVO CONGRESS 2011<br />
der Jahrzehnte des Bürgerkrieges <strong>und</strong> folgender<br />
Hochgeschwindigkeits-globalisierung (ab 1992) eine<br />
– letztendlich sogar staatlich anerkannte – Wiederbelebung<br />
<strong>und</strong> Aufwertung erfahren hat; sowie ein Führer<br />
dessen Prestige auf seiner Rolle innerhalb einer<br />
transnationalen sozio-religiösen Bewegung gründet.<br />
Obwohl alle drei Autoritäten <strong>und</strong> ihre jeweilige Position<br />
eindeutig Produkte der kambodschanischen<br />
Nachkriegszeit (<strong>und</strong> somit der letzten zwei Jahrzehnte<br />
der Globalisierung) darstellen, sind hierbei jedoch<br />
auch durchaus bemerkenswerte historische Kontinuitäten<br />
feststellbar.<br />
Sarah Albrecht (Berlin): Wo ist dār al-islām? Zu<br />
Autorität <strong>und</strong> Territorialität im Diskurs um fiqh<br />
al-aqallīyāt<br />
Die Aufteilung der Welt in dār al-islām („Gebiet des<br />
Islam”), dār al-ḥarb („Gebiet des Krieges“) <strong>und</strong> <strong>and</strong>ere<br />
territoriale Kategorien hat seit der Frühzeit des Islam<br />
eine bedeutende Rolle in islamrechtlichen Kontexten<br />
gespielt. Auch im zeitgenössischen Diskurs um<br />
fiqh al-aqallīyāt – die Auslegung des islamischen<br />
Rechts für Muslime in nicht-islamisch geprägten Gesellschaften<br />
– kommt der Frage nach der Kategorisierung<br />
der Welt entscheidende Bedeutung zu. Am Beispiel<br />
von Yūsuf al-Qaraḍāwī <strong>und</strong> Ṭāhā al-ʿAlwānī,<br />
die sich in ihrer Rolle als Wegbereiter des fiqh alaqallīyāt<br />
als religiöse Autoritäten für Muslime in Europa<br />
<strong>und</strong> Nordamerika positionieren, wird erörtert,<br />
dass sich die Territorialkonzepte der beiden Rechtsgelehrten<br />
erheblich vonein<strong>and</strong>er unterscheiden <strong>und</strong> in<br />
divergierenden Posi<strong>tionen</strong> zum Verhältnis von Muslimen<br />
zu mehrheitlich nicht-muslimischen Gesellschaften<br />
resultieren.<br />
Al-Qaraḍāwī hält an einer dichotomen Einteilung<br />
der Welt fest, indem er zwischen dār al-islām, das er<br />
mit islamisch geprägten Länder identifiziert, <strong>und</strong> ġair<br />
dār al-islām, dem „nicht-islamischen Gebiet“, das den<br />
Rest der Welt umfasst, unterscheidet. Wenngleich er<br />
von klassischen Termini wie dār al-ḥarb Abst<strong>and</strong><br />
nimmt, erhält er die gr<strong>und</strong>legende Annahme aufrecht,<br />
dass die identitätsstiftende Heimat eines Muslims (alwaṭan<br />
al-islāmī) in muslimischen Mehrheitsgesellschaften<br />
verortet sei. Al-ʿAlwānī hingegen weist diese<br />
historisch entwickelten Konzepte mit Verweis auf<br />
fehlende normative Gr<strong>und</strong>lagen als anachronistisch<br />
zurück. Er definiert all jene Länder als „Gebiet des Islam“,<br />
in denen Muslime in Sicherheit leben <strong>und</strong> ihren<br />
religiösen Pflichten nachkommen können. Diesem,<br />
von der Idee einer geographisch lokalisierbaren „islamischen<br />
Welt“ losgelösten Verständnis des dār alislām<br />
entsprechend, ist die religiöse Heimat eines<br />
Muslims nicht an einen physischen Ort, sondern ausschließlich<br />
an einen imaginierten Raum religiöser<br />
Praxis geknüpft.<br />
Jens Kutscher (Erlangen): Was heißt da Fatwa-<br />
Chaos? Wie Muftis die politischen Einstellungen<br />
<strong>und</strong> Verhaltensweisen von Muslimen rechtfertigen<br />
Fatwas von sehr unterschiedlichen Websites haben<br />
oftmals ein<strong>and</strong>er widersprechende Meinungen hervorgebracht,<br />
wenn es um die Rechtleitung von Mus-<br />
22<br />
limen geht. Diese gegensätzlichen Rechtsmeinungen<br />
haben zu dem geführt, was in der Presse nicht selten<br />
als »Fatwa-Chaos« bezeichnet wird. Damit eng verknüpft<br />
ist die Frage nach islamischer Autorität <strong>und</strong> ihrer<br />
Pluralisierung bzw. ihrer Schwächung. Zwar lässt<br />
sich das Verhältnis von Autorität <strong>und</strong> Scharia veranschaulichen<br />
dank Max Webers Idee der Veralltäglichung<br />
charismatischer Herrschaft <strong>und</strong> Hannah<br />
Arendts Überzeugung, dass Autorität weder Zwang<br />
durch Gewalt sei, noch Überredung mit Argumenten.<br />
Vervollständigt wird die Analyse aber vom Konzept<br />
der Marǧaʻiyya.<br />
Bei Marǧaʻiyya geht es um die Rechtleitung von<br />
Muslimen auf Gr<strong>und</strong> der theologischen Auszeichnung<br />
der Muftis, ihrer Anhängerschaft <strong>und</strong> der Abwesenheit<br />
formaler Regeln. Dank ihrer Ausbildung als »Erben<br />
der Propheten« gelingt es Muftis, eigene Anhänger<br />
zu gewinnen <strong>und</strong> ihre Gemeinschaft zu leiten.<br />
Einerseits führt dies zu einem intellektuellen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Wettbewerb zwischen den Gelehrten<br />
um ihre Anerkennung als Träger von Marǧaʻiyya.<br />
Andererseits ist diese zumindest implizite Konkurrenz<br />
um die korrekte Interpretation der normativen Quellen<br />
<strong>und</strong> ihre Anwendung in der politischen Praxis des 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts der Gr<strong>und</strong>, warum Muslime überhaupt<br />
eine Wahl haben.<br />
Es wird deutlich, dass unterschiedliche Muftis – etwa<br />
Yūsuf al-Qaradāwī <strong>und</strong> Muhammad Sālih al-<br />
Munaǧǧid – in der gleichen Frage – nämlich, ob Wählen<br />
aus Sicht der Scharia legitim sei – zu unterschiedlichen<br />
Ergebnissen kommen können – Wählen also<br />
auf Gr<strong>und</strong> der gleichen Rechtsfindungsmethoden für<br />
empfohlen bzw. missbilligt erklären. Doch durch ihre<br />
Arbeit <strong>und</strong> auf der Basis der Tradition versuchen sie,<br />
freiwilligen Gehorsam der Fragesteller – insbesondere<br />
ihrer Anhänger – zu gebieten.<br />
9. Benevolent Engagement among Muslims:<br />
Triggers, Target Groups, Fields of Action<br />
Paula Schrode (Heidelberg): Bedingungen muslimischer<br />
ritueller Wohltätigkeit in Deutschl<strong>and</strong><br />
<strong>und</strong> der Türkei<br />
Islamische rituelle Wohltätigkeitspraktiken transformieren<br />
sich im Zuge sozio-ökonomischen W<strong>and</strong>els;<br />
zugleich verschieben sich durch Migration <strong>und</strong> Globalisierung<br />
soziale Interaktionsräume <strong>und</strong> imaginierte<br />
Grenzen. Das Projekt, aus dem dieser Beitrag berichtet,<br />
widmet sich den damit verb<strong>und</strong>enen (Re-)konstruk<strong>tionen</strong><br />
<strong>und</strong> Materialisierungen von Gemeinschaft<br />
in multiethnischen islamischen Kontexten in Deutschl<strong>and</strong><br />
sowie einer von Migration geprägten ländlichen<br />
Gegend der Türkei.<br />
Die präsentierten Feldforschungsergebnisse stammen<br />
aus einem Dorf der türkischen Schwarzmeerregion.<br />
Das Opferfest als islamische Tradition <strong>und</strong> die<br />
damit verb<strong>und</strong>enen normativ-religiösen Narrative –<br />
das Teilen von Opferfleisch als Ausdruck von Einheit,<br />
Gemeinschaftlichkeit <strong>und</strong> Solidarität – sind zentral an<br />
das Selbstbild der Dorfbewohner als einer muslimischen<br />
Gemeinschaft gekoppelt. Trotz der hohen ideo-