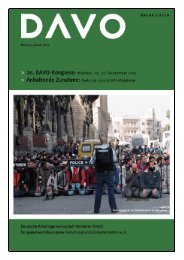4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
Ohne Menschenrechte wie die Glaubens- <strong>und</strong> Meinungsfreiheit<br />
gibt es nicht die Möglichkeit der Entwicklung<br />
(d.h. von Leben) innerhalb der Doktrin einer<br />
Religion.“ (S. 357-8). In diesem Zitat wird nicht nur<br />
einer der wesentlichen Ausgangspunkte in Abdullahi<br />
an-Nai´ms (*1946) islamischem Denken angesprochen,<br />
sondern auch die traurige Realität vieler Schiiten<br />
in Ostsaudiarabien <strong>und</strong> Pakistan sowie einiger<br />
Sunniten im Iran (S. 363). Damit will der sudanesisch-amerikanische<br />
Jurist nicht zuletzt betonen, wie<br />
sehr die Religion sowohl von den Menschenrechten<br />
als auch vom Säkularismus abhängt. Die Trennung<br />
von Kirche <strong>und</strong> Staat hält er für notwendig für die<br />
Ges<strong>und</strong>heit der Religionen (S. 359), weil Menschen<br />
nicht wahrhaftig glauben können, solange der Unglaube<br />
keine Option ist (S. 361).<br />
Die Glaubensfreiheit werde u.a. durch Koranvers<br />
(18:29) bestätigt, in dem es heißt: „Darum lass den<br />
gläubig sein, der will, <strong>und</strong> den ungläubig sein, der<br />
will.“ Wenn an-Na´im von secularism spricht, dann<br />
meint er damit nicht, dass man nicht aus religiösen<br />
Motiven politisch agieren darf, was ja ohnehin schwer<br />
herauszufinden ist (S. 362). Er tritt nicht für einen anti-religiösen<br />
Säkularismus ein, sondern für ein positives<br />
Verhältnis zwischen Religion <strong>und</strong> Staat, der sich<br />
gegenüber den verschiedenen Religionsgemeinschaften<br />
fair <strong>und</strong> neutral zu verhalten hat. An-Na´im unterstreicht,<br />
dass der Begriff „islamischer Staat“ ein Widerspruch<br />
in sich sei: Sobald irgendeine Verhaltensweise<br />
vom Staat aufgezwungen wird, hört sie automatisch<br />
auf, zum Normensystem des Islams zu gehören<br />
(S. 363). Ein angeblich „islamischer Staat“ untergräbt<br />
mit seinen Menschenrechtsverletzungen nicht nur die<br />
Vorstellung von „islamischem Regieren“, sondern sogar<br />
die Gültigkeit des Islams (S. 368).<br />
Der Völkerrechtler an-Na´im unterscheidet zudem<br />
zwischen einer traditionellen Islam-Ausübung, die nur<br />
teilweise mit den Menschenrechten zu vereinbaren ist,<br />
<strong>und</strong> einer progressiven Islam-Ausübung, die mit den<br />
human rights harmoniert. MuslimInnen versucht er zu<br />
überzeugen, dass die progressive Islam-Ausübung die<br />
authentischere ist, während er Menschenrechts-<br />
Befürwortern klar machen möchte, dass eine islamische<br />
Rechtfertigung für die Akzeptanz der Menschenrechte<br />
in mehrheitlich-muslimischen Gesellschaften<br />
von großer Bedeutung ist. Die Menschenrechte <strong>und</strong><br />
die Religion brauchen ein<strong>and</strong>er (S. 354): Werden die<br />
Menschenrechte theologisch als „inakzeptable Neuerung“<br />
(bid´a) betrachtet (S. 359), stoßen sie auf breite<br />
Ablehnung, insbesondere wenn die human rights mit<br />
jenen Ländern identifiziert werden, deren Staaten<br />
mehrheitlich-muslimische Regionen ausgebeutet <strong>und</strong><br />
gedemütigt haben.<br />
An-Na´im hält es für falsch, die Menschenrechtsidee<br />
den englischen Bill of Rights, der amerikanischen<br />
Unabhängigkeitserklärung <strong>und</strong> Verfassung sowie der<br />
französischen Erklärung der Menschen- <strong>und</strong> Bürgerrechte<br />
zuzuschreiben, weil sich diese Rechte nur auf<br />
die Bürger bestimmter Staaten bezogen <strong>und</strong> nicht auf<br />
alle Menschen. Bekräftigt wird dies durch die brutale<br />
koloniale Expansion Engl<strong>and</strong>s <strong>und</strong> Frankreichs in Afrika<br />
<strong>und</strong> Asien, die zeitlich mit diesen Dokumenten<br />
einhergingen. In den USA bedurfte es eines Bürgerkriegs<br />
<strong>und</strong> Verfassungsänderungen, um fast 100 Jahre<br />
nach der Unabhängigkeit die Sklaverei abzuschaffen,<br />
während der Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern<br />
bis ins 20. Jhd. hineinreichte (S. 334).<br />
Da die Diskriminierung von Frauen leider häufig<br />
mit religiösen Gründen gerechtfertigt wird, können<br />
diese groben Menschenrechtsverletzungen nicht beseitigt<br />
werden, ohne ihre angeblich religiöse Begründung<br />
anzusprechen (S. 353). Was sich heute viele nur<br />
schwer vorstellen können, ist dass die Scharia lange<br />
einen positiven Einfluss auf die Frauenrechte hatte:<br />
Dieses Rechtssystem aus dem 7. Jhd. machte aus allen<br />
muslimischen Frauen unabhängige juristische Personen,<br />
verlieh ihnen die Verfügungsgewalt über ihren<br />
Besitz, einen bestimmten Anteil am Erbe sowie den<br />
Zugang zu Bildung. Die Scharia schränkte die Polygamie<br />
ein, räumte der Ehefrau das Scheidungsrecht<br />
ein <strong>und</strong> garantierte ihr das Recht auf Lebensunterhalt<br />
<strong>und</strong> anständige Beh<strong>and</strong>lung. Bis zum 19. Jhd. bräuchte<br />
die Scharia keinen Vergleich mit <strong>and</strong>eren Rechtssystemen<br />
zu scheuen (S. 269). Was an-Na´im dagegen<br />
stark kritisiert, ist wenn versucht wird, die historische<br />
Scharia heute wiedereinzuführen, da sie mit den heute<br />
geltenden Menschenrechtsst<strong>and</strong>ards nicht übereinstimmt<br />
(S. 27).<br />
Die nicht immer leicht zu verstehende juristische<br />
Sprache dieses Buches macht der einw<strong>and</strong>freie Inhalt<br />
wieder wett. Andernfalls sei auf an-Nai´ims äußerst<br />
empfehlenswertes Islam <strong>and</strong> the Secular State hingewiesen,<br />
ebenso wie auf seine Übersetzung The Second<br />
Message of Islam, in der die Islam-Interpretation seines<br />
beeindruckenden Lehrers Mahmud Muhammad<br />
Taha (1909-85) verdeutlicht wird.<br />
Luay Radhan, Heidelberg<br />
� � �<br />
Angern, Wolf-Hagen von (2010): Geschichtskonstrukt<br />
<strong>und</strong> Konfession im Libanon. – Logos: Berlin,<br />
482 S.<br />
Nothing to say about the war<br />
Don’t feel that I am typical Lebanese<br />
Nor typical Arab<br />
Have nothing to do with Phoenicians<br />
Not ready to defend the Palestinian cause<br />
Know almost nothing about politics<br />
Often contradict myself<br />
Diesen Vers der libanesischen Künstlerin Mounira<br />
al-Solh stellt der Autor an den Anfang seines Werkes<br />
<strong>und</strong> greift damit trefflich auf den Nucleus, oder besser<br />
die Nuclei libanesischer Identität(en) vor. Was bedeutet<br />
es Libanese zu sein? Wie konstituiert sich libanesische<br />
Identität? Diese Fragen können unmöglich eindimensionale<br />
Antworten zur Folge haben. Der Libanon<br />
beherbergt in einzigartiger Weise eine Vielzahl<br />
konfessioneller Gruppen auf engstem Raum. Neben<br />
orthodoxen Sunniten <strong>und</strong> Zwölferschiiten existiert in<br />
diesem L<strong>and</strong> die in Relation zur Bevölkerungszahl<br />
größte Gruppe von Christen im Vorderen Orient. Daneben<br />
findet sich die zwar kleine, aber sehr einfluss-<br />
1<br />
161