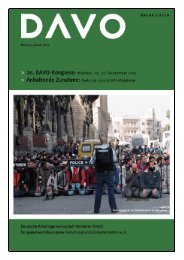4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DISSERTATIONEN DISSERTATIONS<br />
schichtsbildern entwickelt Kapitel 8, „Geschichte <strong>und</strong><br />
Identität“ (S. 382-415), darüber hinaus als Ergänzung<br />
zu den jeweils gruppentypischen Geschichtsbildern<br />
für jede untersuchungsrelevante Konfession ein holzschnittartiges<br />
konfessionstypisches Identitätskonstrukt<br />
(bzw. im Fall der sunnitischen Gruppe zwei), das auf<br />
den gruppenperspektivisch formulierten historischen<br />
Narrativen, Argumentationslinien <strong>und</strong> H<strong>and</strong>lungslogiken<br />
beruht, die in Kapitel 6 als gruppenverbindlich<br />
herausgefiltert <strong>und</strong> in allgemeiner Form formuliert<br />
werden konnten.<br />
Dabei wird es dem Leser bewusst überlassen, dem<br />
Autor in seinen Auffassungen <strong>und</strong> von ihm formulierten<br />
Identitätskonstrukten zu folgen, oder, aufgr<strong>und</strong> der<br />
transparenten Darstellung in Kapitel 6, zu eigenen<br />
abweichenden oder ergänzenden Schlüssen zu gelangen.<br />
Das Fazit der Dissertation (Kap. 9, S. 416-439) stellt<br />
jeweils die einzelnen Geschichts- <strong>und</strong> Identitätskonstrukte<br />
– wiederum analog zu den sechs Interviewfragen<br />
– tabellarisch gegenüber <strong>und</strong> zeigt auf, inwieweit<br />
die Geschichten <strong>und</strong> Identitäten der verschiedenen<br />
Gruppen kompatibel oder inkompatibel, sich gegenseitig<br />
ergänzend oder widersprechend, <strong>und</strong> schließlich<br />
der friedlichen Koexistenz der libanesischen Konfessionen<br />
förderlich oder hinderlich sind. Hierbei fällt<br />
besonders auf, dass die jeweiligen Geschichtsbilder<br />
allzu oft erstaunlich wenig vonein<strong>and</strong>er abweichen,<br />
<strong>und</strong> dass selbst die Motiva<strong>tionen</strong>, H<strong>and</strong>lungszwänge<br />
oder Interessen der jeweiligen historischen „Gegner“<br />
mit großem Verständnis – ja teilweise mit Anteilnahme<br />
– wahrgenommen <strong>und</strong> wiedergegeben werden. Die<br />
aus diesen relativ ähnlichen Geschichtsbildern jedoch<br />
gezogenen Schlüsse auf die eigenen Gruppenidentitäten<br />
unterscheiden sich umso mehr – teilweise in frappierender<br />
Weise – vonein<strong>and</strong>er. Eine Erkenntnis, die<br />
für das Verständnis der konfliktträchtigen libanesischen<br />
Geschichte <strong>und</strong> Gegenwart von durchaus großem<br />
Nutzen sein kann.<br />
102<br />
� � �<br />
Behrouz Alikhani: Institutionelle Ent-Demokratisierungsprozesse<br />
als Folge eines Nachhinkeffekts<br />
des sozialen Habitus am Beispiel der französischen,<br />
deutschen <strong>und</strong> iranischen Gesellschaft. – Abgeschlossene<br />
Dissertation am Institut für Soziologie der<br />
Leibniz Universität Hannover. Betreuer Prof. Dr.<br />
Dawud Gholamasad <strong>und</strong> Prof. Dr. Ingolf Ahlers.<br />
Bei der Dissertation h<strong>and</strong>elt es sich um eine empirisch-theoretisch<br />
vergleichende Untersuchung der<br />
Sozio- <strong>und</strong> Psychogenese des Scheiterns der „Zweiten<br />
Republik“ in Frankreich (1848-1852), der „Weimarer<br />
Republik“ in Deutschl<strong>and</strong> (1918-1933) <strong>und</strong> der „Konstitutionellen<br />
Monarchie“ im Iran (1906-1925). Die<br />
Strukturähnlichkeiten dieser Prozesse jenseits ihrer<br />
Gestaltunterschiede wurden begrifflich als „Institutionelle<br />
Ent-Demokratisierungsprozesse“ als Folge eines<br />
„Nachhinkeffekts des sozialen Habitus“ erfasst.<br />
Der Untersuchung lag ein prozesssoziologisches<br />
Demokratiemodell zugr<strong>und</strong>e. Die Stärke dieses Modells<br />
besteht darin, dass dabei nicht nur die „institutionelle“<br />
Dimension von Demokratisierungs- <strong>und</strong> Ent-<br />
Demokratisierungsprozessen berücksichtigt werden,<br />
sondern auch ihre „funktionalen“ <strong>und</strong> „habituellen“.<br />
Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf der Untersuchung<br />
der Struktur der letzteren beiden Dimensionen,<br />
die von den dominanten Demokratietheorien derzeit<br />
relativ vernachlässigt werden, sowie auf dem Problem<br />
der Ungleichzeitigkeiten der Entwicklungen dieser<br />
drei Dimensionen.<br />
Bei allen drei Fallbeispielen ist aus einer prozesssoziologischen<br />
Perspektive zeitgleich mit einem vollzogenen<br />
Demokratisierungsschub auf der institutionellen<br />
Ebene ein „Nachhinkeffekt des sozialen Habitus“ der<br />
beteiligten Menschen zu verzeichnen. Insofern sind<br />
die anschließenden „institutionellen Ent-Demokratisierungsprozesse“<br />
als Funktion bestimmter „Habituszwänge“<br />
der in diese Prozesse involvierten Menschen<br />
zurückzuführen, die auf eine Wiederherstellung<br />
der vertrauten Funktionszusammenhänge auf „institutioneller“<br />
<strong>und</strong> „funktionaler“ Ebene hindrängen.<br />
Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine kritische<br />
Würdigung der vor allem im Iran dominierenden Theorieansätze<br />
zur Erklärung der institutionellen Ent-<br />
Demokratisierung während der „konstitutionellen<br />
Monarchie“ als Folge einer erfolgreichen Revolution.<br />
Im ersten Kapitel wird exemplarisch auf den ideengeschichtlichen<br />
Theorieansatz von Javad Tabatabai, den<br />
historiographischen Ansatz von Mansoureh Ettehadieh<br />
<strong>und</strong> den soziologischen Ansatz von Homa Katouzian<br />
als bekannte VertreterInnen verschiedener humanwissenschaftlicher<br />
Disziplinen im Iran eingegangen.<br />
Durch eine kritische Einordnung <strong>und</strong> Interpretation<br />
dieser Ansätze wird der Leser einführend auf das<br />
zweite Kapitel vorbereitet, das die Darstellung des<br />
prozesssoziologischen Demokratiemodells <strong>und</strong> dessen<br />
theoretische Implika<strong>tionen</strong> umfasst.<br />
In der Untersuchung werden nicht nur vergleichend<br />
die raum-zeitlichen Dimensionen der institutionellen<br />
Ent-Demokratisierungsprozesse berücksichtigt, sondern<br />
auch ihre fünfte Dimension, also ihre symbolische,<br />
die sich auf Orientierungs-, Kommunikations-<br />
<strong>und</strong> Kontrollmittel sowohl der involvierten Menschen<br />
als Träger dieser Prozesse als auch deren Forscher