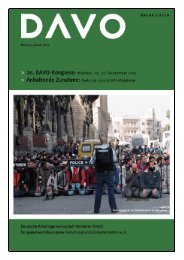4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
nigen (insane) Angriff auf die unbewaffneten Schiffe.<br />
Mit patriotischem Stolz habe er von 1964 bis 1966 in<br />
der israelischen Armee gedient, die in jenen Tagen zu<br />
recht Israelische Verteidigungsstreitmacht genannt<br />
worden sei. In den vergangenen vier Jahrzehnten sei<br />
“meine Armee” jedoch zu einer brutalen Polizei einer<br />
wilden Kolonialmacht heruntergekommen. Die derzeitige<br />
israelische Regierung nannte er die am meisten<br />
rechts gerichtete <strong>und</strong> rassistischste in der Geschichte<br />
des L<strong>and</strong>es. Ihr Verhalten sei zunehmend irrational,<br />
<strong>und</strong> mit dem Befehl zu dem völlig unprovozierten<br />
Angriff auf unschuldige Zivilisten habe sie eine weitere<br />
“rote Linie” überschritten. “Die Komm<strong>and</strong>os<br />
verübten ein kaltblütiges Massaker.”<br />
Wolfgang Köhler, London<br />
� � �<br />
Tamcke, Martin, Arthur Manukyan (Hrsg.): Kulturbegegnungen<br />
zwischen Imagination <strong>und</strong> Realität.<br />
– Ergon Verlag: Würzburg, 2010, 195 S.<br />
Im zweiten B<strong>and</strong> der Reihe „Orthodoxie, Orient <strong>und</strong><br />
Europa“ versammeln die Herausgeber Martin Tamcke<br />
(Göttingen) <strong>und</strong> Arthur Manukyan (Göttingen) acht<br />
Beiträge, in denen aus den verschiedensten Perspektiven<br />
das komplexe Spannungsfeld zwischen Kulturbegegnungen,<br />
Erwartungen <strong>und</strong> Vorstellungen sowie<br />
tatsächlichen Realitäten aufgezeigt wird. Die dem<br />
Reisen innewohnende Problematik vorh<strong>and</strong>ener, oft<br />
unbewusster Erwartungen beim Reisenden, die in<br />
Verbindung mit dem vor Ort Erlebten <strong>und</strong> Gesehenen<br />
oftmals ein verzerrtes Bild erzeugen <strong>und</strong> Stereotypen<br />
festigen können, wurde insbesondere in Bezug auf<br />
Reisen in „den Orient“ ausführlich in der entsprechenden<br />
Literatur erörtert. Schon Edward Said widmete<br />
sich bei der Darlegung seines Orientalismus-<br />
Begriffes den (v.a. französischen <strong>und</strong> englischen)<br />
Reiseberichten des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. Nicht nur auf die<br />
orientalische Welt, sondern auf das moderne Reisen<br />
allgemein bezog sich auch Hans-Magnus Enzensberger<br />
mit seinem vielzitierten Satz „Der Tourist zerstört,<br />
was er sucht, indem er es findet“.<br />
Im vorliegenden Sammelb<strong>and</strong> werden nun unter Berücksichtigung<br />
dieser möglichen Prägungen <strong>und</strong> Erwartungen<br />
die Wahrnehmung <strong>und</strong> die Darstellung des<br />
Wahrgenommenen von Akteuren untersucht, deren<br />
Perspektive bisher weitgehend unberücksichtigt blieb:<br />
So ist der erste Teil des B<strong>and</strong>es („Imagination <strong>und</strong><br />
Realität“) dem Blick auf die orientalische Welt <strong>und</strong><br />
die islamische Religion sowie deren Darstellung gewidmet.<br />
Martin Tamcke stellt im ersten Beitrag die<br />
Berichte deutscher Militärmediziner vor, die im Ersten<br />
Weltkrieg in Aleppo stationiert waren. Während<br />
in einem Reisebericht Aleppo als „Märchen“ bezeichnet<br />
wird, wird die Stadt im nächsten Bericht als<br />
„Bratpfanne des Teufels“ beschrieben, um nur zwei<br />
der zitierten Reiseberichte zu erwähnen. Tamcke<br />
kommt zu dem Schluss, dass in den vorliegenden Berichten<br />
ein „unauflösliches Gewebe von Imagination<br />
<strong>und</strong> Realität“ vorzufinden sei, das eben aufgr<strong>und</strong> der<br />
unterschiedlichen Vorbildung <strong>und</strong> der jeweiligen eigenen<br />
Verortung in der Welt zu sehr unterschiedlichen<br />
Darstellungen ein <strong>und</strong> desselben Ortes, in diesem<br />
Falle Aleppo, führen könnten.<br />
Der bei Tamcke erwähnte Aspekt der eigenen Verortung<br />
ist auch in den folgenden zwei Beiträgen von<br />
maßgeblicher Bedeutung, wenn – zunächst von<br />
Arthur Manukyan, dann von Christian Mauder (Göttingen)<br />
die Sicht der Herrenhuter Brüdergemeinde aus<br />
dem späten 18. Jahrh<strong>und</strong>ert auf den Islam rekonstruiert<br />
wird. Manukyan setzt sich ausführlich mit Konzepten<br />
von Heimat, Fremde <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen<br />
ausein<strong>and</strong>er, bevor er u.a. die Kontakte der Herrenhuter<br />
mit den ägyptischen Kopten skizziert <strong>und</strong><br />
konstatiert, dass die zahlreichen Begegnungen dieser<br />
Glaubensgemeinschaft mit „den Anderen“ <strong>und</strong> deren<br />
Beschreibung auch dem Zweck diente, „sich in der<br />
Fremde beheimatet zu fühlen“. Gleichzeitig dienten<br />
die beschriebenen Mechanismen auch der Vorbereitung<br />
weiterer missionarischer Reisen in die Fremde.<br />
Der folgende Beitrag vertieft Manukyans Analyse<br />
durch eine eingehende Darstellung der Briefwechsel<br />
zwischen den Herrenhutern <strong>und</strong> den ägyptischen Kopten<br />
im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert, in dem Christian Mauder ein<br />
Überlegenheitsgefühl auf Seiten der Herrenhuter beobachtet.<br />
Der zweite Teil („Dialog“) eröffnet Einblicke in einen<br />
weiteren Blickwinkel, jenen der Orthodoxie. Zunächst<br />
widmet sich Wolfgang Reiss (Wien) in seinem<br />
hochinteressanten Beitrag mit aktuellem Bezug dem<br />
interreligiösen Dialog aus griechisch-orthodoxer Perspektive<br />
<strong>und</strong> stellt anfangs klar, dass es bis heute keine<br />
offizielle Stellungnahme von orthodoxer Seite hinsichtlich<br />
des eigenen Verhältnisses zu den nichtchristlichen<br />
Religionen gebe, was u.a. darauf zurückzuführen<br />
sei, dass es bisher kein panorthodoxes Konzil gegeben<br />
habe. Nach der Vorstellung zweier theologischer<br />
Ansätze zu einem solchen interreligiösen Dialog<br />
geht Reiss auf das Verhältnis der griechischorthodoxen<br />
Kirche zum Judentum ein, bevor er das<br />
Verhältnis zum Islam erörtert. Bezüglich des Judentums<br />
konstatiert Reiss u. a., dass die griechischorthodoxe<br />
Kirche nicht jene Notwendigkeit eines Dialogs<br />
bzw. einer Erneuerung des Verhältnisses zum<br />
Judentum sieht, wie es bei den westlichen Kirchen der<br />
Fall sei, während der Dialog mit dem Islam, dem sich<br />
die griechisch-orthodoxe Kirche in soziokultureller<br />
Hinsicht mitunter näher fühle als mit dem Westen,<br />
eher dem pragmatischen Ziel diene, das Zusammenle-<br />
211