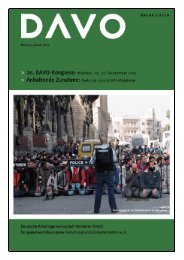4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
neben den von al-Šāfi’ī zusammengestellten vier klassischen<br />
Rechtsquellen zusätzlich vor allem auf die<br />
Berücksichtigung des Allgemeinwohls (maslaha) <strong>und</strong><br />
auf die eigenständige Interpretation der Quellen<br />
(Idschtihad), die sich entweder auf bekannte Präzedenzfälle<br />
bezieht oder neue für muslimische Minderheiten<br />
schafft. Die Praxistauglichkeit einer Rechtsmeinung<br />
in der Lebenswirklichkeit der Gläubigen ist<br />
hier das entscheidende Merkmal. Daran anknüpfend<br />
identifiziert Albrecht drei Leitprinzipien, die für das<br />
Minderheitenrecht maßgeblich sind: (1) die Berücksichtigung<br />
von Zeit, Ort <strong>und</strong> Umständen eines Falles,<br />
(2) die Erleichterung (taysīr) für den Muslim basierend<br />
u.a. auf Sure 2:185 <strong>und</strong> (3) die Gradualität (tadarruj)<br />
der Vorgehensweise, dank der sich die betreffenden<br />
Gläubigen schrittweise mit islamischen Vorschriften<br />
vertraut machen können. Diese Prinzipien<br />
»bieten ihm [al-Qaradāwī] im iftā’ die argumentative<br />
Basis für die Berücksichtigung der Lebensumstände<br />
muslimischer Minderheiten <strong>und</strong> räumen die Möglichkeit<br />
ein, regulär Verbotenes in Ausnahmefällen zu legitimieren.«<br />
(76) Damit kommt al-Qaradāwī dem einzelnen<br />
Muslim entgegen, um derart das Wohl der<br />
Gemeinschaft <strong>und</strong> deren muslimische Identität zu<br />
stärken. Denn wenn jeder Einzelne sich mit islamischen<br />
Normen <strong>und</strong> islamischer Autorität verb<strong>und</strong>en<br />
fühlt, dann diene dies auch der Stärkung der islamischen<br />
Erweckungs-Bewegung (sahwa).<br />
So ist denn auch der Beratungsbedarf für Muslime<br />
außerhalb muslimischer Mehrheitsgesellschaften<br />
hoch. al-Qaradāwī unterscheidet sechs große Themenkomplexe,<br />
die die Notwendigkeit für die Entwicklung<br />
eines Minderheitenrechts verdeutlichen <strong>und</strong><br />
die sich auf der ganzen Welt ähneln: (1) Loyalität gegenüber<br />
dem nichtislamischen Staat <strong>und</strong> politische<br />
Partizipation, (2) Einhaltung der Speisevorschriften,<br />
(3) Verhalten gegenüber Nichtmuslimen, (4) Eherecht,<br />
(5) Erbrecht <strong>und</strong> (6) Umgang mit Banken <strong>und</strong><br />
Versicherungen. Albrecht stellt jedoch fest, dass in al-<br />
Qaradāwīs Fatwas in erster Linie folgende Themenfelder<br />
relevant sind: familienrechtliche Anfragen (insbesondere<br />
zur Eheschließung), der Umgang mit<br />
Nichtmuslimen <strong>und</strong> finanzielle Fragen. Die drei Leitprinzipien<br />
des Minderheitenrechts finden sich in den<br />
von Albrecht vorgestellten charakteristischen Fatwa-<br />
Beispielen zur gemischtreligiösen Ehe, zu nichtislamischen<br />
Feiertagen <strong>und</strong> zum kreditgestützten Hauskauf<br />
hingegen nur bedingt wieder. Sie selbst räumt<br />
ein, dass der Gr<strong>und</strong>satz der Gradualität kaum vorkommt.<br />
Stattdessen spielen der Koran als Rechtsquelle<br />
sowie das Prinzip der Notwendigkeit (darūra), aber<br />
stellenweise auch das oben genannte Prinzip der Erleichterung<br />
eine wichtige Rolle.<br />
al-Qaradāwīs Minderheitenrecht stellt das Recht des<br />
Aufenthaltsl<strong>and</strong>es wenn nötig über islamische Vorschriften.<br />
Gleichzeitig sei aber der Islam das identitätsstiftende<br />
Merkmal aller Muslime ohne Rücksicht<br />
auf ihre persönlichen Hintergründe. Dieser Widerspruch<br />
führt letztlich zu Segregations-Tendenzen,<br />
wenn etwa Muslime die Nachbarschaft von Muslimen<br />
suchen sollen, um so islamkonform zu leben, wie sie<br />
sich das wünschen. »Ob <strong>und</strong> inwieweit dieses Bestreben,<br />
eine muslimische Sub- bzw. Parallelgesellschaft<br />
zu errichten, dem übergeordneten Ziel, da’wa unter<br />
der nicht-muslimischen Bevölkerungsmehrheit zu betreiben,<br />
dienlich ist, erscheint indes fragwürdig.« (97)<br />
al-Qaradāwīs Rechtsmeinung ist folglich auch nicht<br />
unumstritten. Albrecht nennt zum Beispiel mit Tariq<br />
Ramadan einen Denker, der den Terminus »Minderheit«<br />
äußerst kritisch sieht, um nur eine Gegenmeinung<br />
herauszugreifen.<br />
Zwar gibt es einige, letztlich marginale begriffliche<br />
Unschärfen <strong>und</strong> formale Uneinheitlichkeiten in der<br />
ansonsten äußerst sauber redigierten Arbeit von Sarah<br />
Albrecht. Doch sie ist insgesamt f<strong>und</strong>iert recherchiert<br />
<strong>und</strong> beschränkt sich auf das Wesentliche zum Thema,<br />
wobei viele Fußnoten weiterführende Hinweise enthalten.<br />
Weitere Studien zu <strong>and</strong>eren Aspekten eines<br />
wie auch immer gearteten islamischen Minderheitenrechts<br />
sind darin angelegt. Mit ihrer Arbeit hat Sarah<br />
Albrecht einen sehr erfreulichen Beitrag dazu geleistet.<br />
Jens Kutscher, Erlangen<br />
� � �<br />
al-Mdaires, Falah Abdullah (2010): Islamic Extremism<br />
in Kuwait. From the Muslim Brotherhood<br />
to al-Qaeda <strong>and</strong> other Islamist Political Groups. –<br />
Routledge: London & New York, 292 p.<br />
Der vorliegende B<strong>and</strong> des kuwaitischen Politikwissenschaftsprofessors<br />
Falah Abdullah al-Mdaires, der<br />
bereits eine beachtliche Anzahl arabischsprachiger<br />
Studien über die historische Genese aller wesentlichen<br />
politischen Strömungen in Kuwait verfasst hat,<br />
schreibt sich auf die Fahnen erstmals einen kompletten<br />
Überblick über den islamischen Extremismus in<br />
Kuwait zu liefern. Bereits in der historischen Heranführung<br />
an das Thema (Kapitel 1: The roots of the Islamist<br />
political groups) wird deutlich, dass seitens des<br />
Autors von einer fragwürdigen impliziten Deckungsgleichheit<br />
zwischen Islamismus <strong>und</strong> islamischen Extremismus<br />
ausgegangen wird. Dementsprechend findet<br />
sich auch in allen weiteren Kapitelbezeichnungen beständig<br />
der Terminus Islamist, ganz im Gegensatz<br />
zum Titel gebenden islamischen Extremismus. Das<br />
159