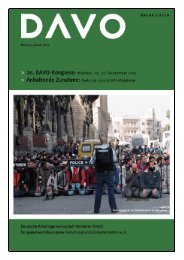4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
4 Dissertationen und Habilita- tionen / Dissertations and Habilitations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
REZENSIONEN BOOK REVIEW<br />
leumdung einer bestimmten Gruppe wehren, über dieses<br />
Thema informieren wollen.<br />
Luay Radhan, Heidelberg<br />
� � �<br />
Schneiders, Thorsten (Hrsg. 2010): Islamverherrlichung<br />
– Wenn die Kritik zum Tabu wird. – VS<br />
Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden, 401 S.<br />
„In den Dialog treten heißt, eingestehen, dass auch<br />
der Andere Recht haben kann“ (Hans Georg Gadamer)<br />
mit diesem Zitat endet Haci-Halil Uslucan seinen<br />
Beitrag innerhalb des umfangreichen Sammelb<strong>and</strong>es<br />
von Gerald Schneiders. Auch in diesem B<strong>and</strong><br />
liest sich das „Who is Who“ der Islam- <strong>und</strong> Integrations-Gallionsfiguren<br />
Deutschl<strong>and</strong>s, wie etwa Katajun<br />
Amirpur, Hartmut Bobzin, Kemal Bozay, Rainer<br />
Brunner, Rabeya Müller u.a.<br />
Der gesamte B<strong>and</strong> ist aufgeteilt in drei große Kapitel:<br />
� Gr<strong>und</strong>lagen des theoretischen Diskurses,<br />
� Gegenwärtiger Umgang mit dem islamischen Erbe<br />
in Europa,<br />
� Verhalten <strong>und</strong> Eigendarstellung von Muslimen in<br />
Deutschl<strong>and</strong>.<br />
Ein Vierh<strong>und</strong>ertseitenwerk zu rezensieren stellt eine<br />
besondere Herausforderung dar, wenn die wissenschaftlich<br />
besonders wertvollen Erkenntnisse kurz<br />
<strong>und</strong> knapp dargestellt werden sollen. An dieser Stelle<br />
kann lediglich eine Auswahl aus den vielfältigen Erkenntnissen<br />
wiedergegeben werden.<br />
Wussten Sie, dass es drei Hauptansätze zur Interpretation<br />
der frühen Quellen zum Islam gibt? David Kiltz<br />
verdeutlicht dies mittels des traditionalistischen, des<br />
revisionistischen <strong>und</strong> des integrativen Ansatzes. (Vgl.<br />
S. 19 ff.) In seinem Beitrag „Schatten über den Anfängen<br />
– Was sagen frühe Quellen zum Islam über<br />
das aus, was wirklich war?“ geht er – vereinfacht ausgedrückt<br />
– drei Erklärungsansätzen früherer Quellen<br />
nach. Hierbei unterscheidet er innerislamische literarische<br />
Quellen, außerislamische literarische Quellen<br />
<strong>und</strong> Realien bzw. Inschriften <strong>und</strong> bildliche Darstellungen.<br />
Die „Traditionalisten“ in der islamischen Welt folgen<br />
nach Kiltz im Wesentlichen der innerislamischen<br />
Überlieferung, d.h. der Tradition. Dabei wird diese als<br />
weitgehend historisch korrekt angesehen. In der tradi-<br />
tionellen westlichen Islamwissenschaft werden nach<br />
Kiltz die klassischen islamischen Werke nach kritischer<br />
Sichtung ebenfalls als wesentliche Basis für die<br />
frühislamische Geschichte verwendet (vgl. S. 20). Zu<br />
den Vertretern der „klassischen Schule“ werden bspw.<br />
William Montgomery Watt <strong>und</strong> Rudi Paret gezählt.<br />
Im revisionistischen Ansatz werden die islamischen<br />
Prophetenbiographien <strong>und</strong> Erzählungen zu historischen<br />
Ereignissen als „heilsgeschichtliche“ Konstrukte<br />
abgelehnt. John Wansbrough, Patricia Crone <strong>und</strong><br />
Michael Cook werden hierbei zu den bekannten Vertretern<br />
dieser Richtung gezählt. Crone habe sogar versucht,<br />
ganz ohne traditionelle islamische Quellen eine<br />
Rekonstruktion der frühislamischen Geschichte vorzunehmen<br />
<strong>und</strong> sich dabei nur mit außerislamischen<br />
Quellen befasst (vgl. S. 21). Der vor allem bekannteste<br />
Vertreter der revisionistischen Richtung ist der Islamwissenschaftler<br />
Muhammad Sven Kalisch, der die<br />
Existenz des Propheten „Muhammad“ gemäß dieser<br />
Richtung negiert. Seiner Ansicht nach hat es den Propheten<br />
nicht gegeben (vgl. S. 21).<br />
Der dritte als „integrative“ Schule bezeichnete Ansatz<br />
erachtet die Herkunft des Propheten Muhammed<br />
aus Mekka als wahrscheinlich <strong>und</strong> versucht die verschiedenen<br />
Quellen zu harmonisieren. Hierbei soll der<br />
Blick „von außen“ helfen, den Koran nicht als historisch<br />
unmittelbar auswertbare Quelle zu sehen, sondern<br />
als literarisch-kodierte Aussage über seine Zeit<br />
<strong>und</strong> über seine Genese. Zu den Vertretern dieses Ansatzes<br />
werden u.a. Angelika Neuwirth, Gabriel Said<br />
Reynolds, Michael Cuypers etc. gezählt (vgl. S. 26).<br />
Im Beitrag von Felix Körner „Der Koran ist mehr<br />
als die Aufforderung, anständig zu sein. Hermeneutische<br />
Neuansätze zur historisch-kritischen Auslegung<br />
in der Türkei“ werden türkische Theologen <strong>und</strong> ihre<br />
historisch-kritische Schriftauslegung näher betrachtet<br />
(vgl. S. 29 ff.). Er versucht dies am Beispiel der Neuansätze<br />
von zwei türkischen Wissenschaftlern namens<br />
Mehmet Pacaci <strong>und</strong> Ömer Özsoy darzustellen. Beide<br />
haben beachtliche akademisch-theologische Karrieren.<br />
Mehmet Pacaci arbeitet im türkischen Staatsdienst<br />
als Religionsattaché in Washington D.C. <strong>und</strong><br />
Ömer Özsoy als Professor für Islamische Religion an<br />
der Universität Frankfurt. Körner konstatiert den beiden<br />
„ein hohes Maß an historisch-kritischem Denken“:<br />
Sie berücksichtigen u.a.<br />
� das Bezogenheitskriterium, d.h. der Koran ist kontextbezogen<br />
zu verstehen, auszulegen <strong>und</strong> zu rekonstruieren;<br />
� das Beschränktheitskriterium, d.h. der Koran kann<br />
hinsichtlich seiner Botschaft <strong>und</strong> Formulierung unterschiedlich<br />
verst<strong>and</strong>en werden. Damit ist ein Verständnis<br />
für die Beschränktheit von Formulierungen<br />
zu zeigen;<br />
� das Abst<strong>and</strong>s-Kriterium, d. h. Skepsis gegenüber der<br />
Verschriftlichung des Koran dahingehend zu zeigen,<br />
dass der Leser den Appell im Koran, die angestrebte<br />
Suggestion wie auch den Unterscheid zwischen<br />
zeitgenössischem <strong>und</strong> dem koranischen Arabisch<br />
bewusst <strong>und</strong> mit geschichtlichem Abst<strong>and</strong> versteht.<br />
205