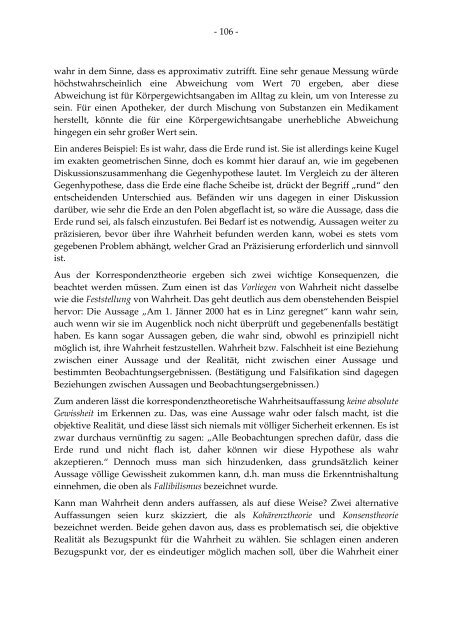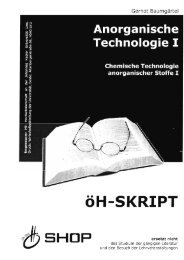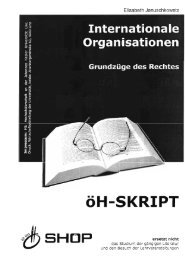Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 106 -<br />
wahr in dem Sinne, dass es approximativ zutrifft. Eine sehr genaue Messung würde<br />
höchstwahrscheinlich eine Abweichung vom Wert 70 ergeben, aber diese<br />
Abweichung ist für Körpergewichtsangaben im Alltag zu klein, um von Interesse zu<br />
sein. Für einen Apotheker, <strong>der</strong> durch Mischung von Substanzen ein Medikament<br />
herstellt, könnte die für eine Körpergewichtsangabe unerhebliche Abweichung<br />
hingegen ein sehr großer Wert sein.<br />
Ein an<strong>der</strong>es Beispiel: Es ist wahr, dass die Erde rund ist. Sie ist allerdings keine Kugel<br />
im exakten geometrischen Sinne, doch es kommt hier darauf an, wie im gegebenen<br />
Diskussionszusammenhang die Gegenhypothese lautet. Im Vergleich zu <strong>der</strong> älteren<br />
Gegenhypothese, dass die Erde eine flache Scheibe ist, drückt <strong>der</strong> Begriff „rund“ den<br />
entscheidenden Unterschied aus. Befänden wir uns dagegen in einer Diskussion<br />
darüber, wie sehr die Erde an den Polen abgeflacht ist, so wäre die Aussage, dass die<br />
Erde rund sei, als falsch einzustufen. Bei Bedarf ist es notwendig, Aussagen weiter zu<br />
präzisieren, bevor über ihre Wahrheit befunden werden kann, wobei es stets vom<br />
gegebenen Problem abhängt, welcher Grad an Präzisierung erfor<strong>der</strong>lich und sinnvoll<br />
ist.<br />
Aus <strong>der</strong> Korrespondenztheorie ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen, die<br />
beachtet werden müssen. Zum einen ist das Vorliegen von Wahrheit nicht dasselbe<br />
wie die Feststellung von Wahrheit. Das geht deutlich aus dem obenstehenden Beispiel<br />
hervor: Die Aussage „Am 1. Jänner 2000 hat es in Linz geregnet“ kann wahr sein,<br />
auch wenn wir sie im Augenblick noch nicht überprüft und gegebenenfalls bestätigt<br />
haben. Es kann sogar Aussagen geben, die wahr sind, obwohl es prinzipiell nicht<br />
möglich ist, ihre Wahrheit festzustellen. Wahrheit bzw. Falschheit ist eine Beziehung<br />
zwischen einer Aussage und <strong>der</strong> Realität, nicht zwischen einer Aussage und<br />
bestimmten Beobachtungsergebnissen. (Bestätigung und Falsifikation sind dagegen<br />
Beziehungen zwischen Aussagen und Beobachtungsergebnissen.)<br />
Zum an<strong>der</strong>en lässt die korrespondenztheoretische Wahrheitsauffassung keine absolute<br />
Gewissheit im Erkennen zu. Das, was eine Aussage wahr o<strong>der</strong> falsch macht, ist die<br />
objektive Realität, und diese lässt sich niemals mit völliger Sicherheit erkennen. Es ist<br />
zwar durchaus vernünftig zu sagen: „Alle Beobachtungen sprechen dafür, dass die<br />
Erde rund und nicht flach ist, daher können wir diese Hypothese als wahr<br />
akzeptieren.“ Dennoch muss man sich hinzudenken, dass grundsätzlich keiner<br />
Aussage völlige Gewissheit zukommen kann, d.h. man muss die Erkenntnishaltung<br />
einnehmen, die oben als Fallibilismus bezeichnet wurde.<br />
Kann man Wahrheit denn an<strong>der</strong>s auffassen, als auf diese Weise? Zwei alternative<br />
Auffassungen seien kurz skizziert, die als Kohärenztheorie und Konsenstheorie<br />
bezeichnet werden. Beide gehen davon aus, dass es problematisch sei, die objektive<br />
Realität als Bezugspunkt für die Wahrheit zu wählen. Sie schlagen einen an<strong>der</strong>en<br />
Bezugspunkt vor, <strong>der</strong> es eindeutiger möglich machen soll, über die Wahrheit einer