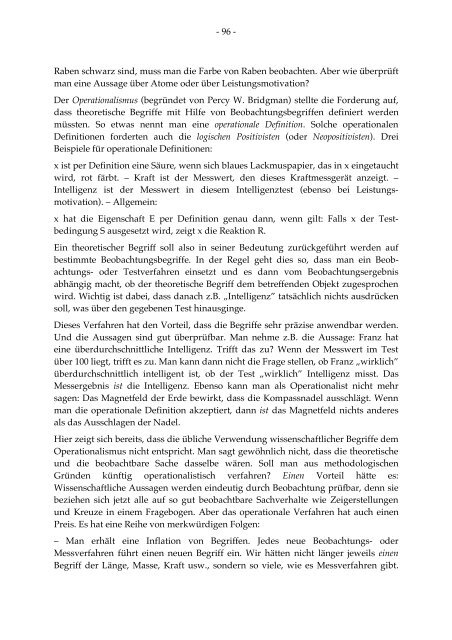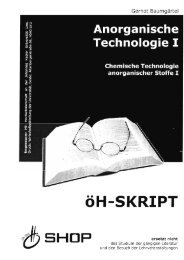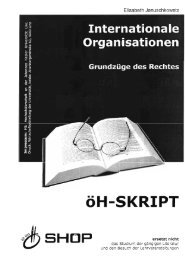Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 96 -<br />
Raben schwarz sind, muss man die Farbe von Raben beobachten. Aber wie überprüft<br />
man eine Aussage über Atome o<strong>der</strong> über Leistungsmotivation?<br />
Der Operationalismus (begründet von Percy W. Bridgman) stellte die For<strong>der</strong>ung auf,<br />
dass theoretische Begriffe mit Hilfe von Beobachtungsbegriffen definiert werden<br />
müssten. So etwas nennt man eine operationale Definition. Solche operationalen<br />
Definitionen for<strong>der</strong>ten auch die logischen Positivisten (o<strong>der</strong> Neopositivisten). Drei<br />
Beispiele für operationale Definitionen:<br />
x ist per Definition eine Säure, wenn sich blaues Lackmuspapier, das in x eingetaucht<br />
wird, rot färbt. – Kraft ist <strong>der</strong> Messwert, den dieses Kraftmessgerät anzeigt. –<br />
Intelligenz ist <strong>der</strong> Messwert in diesem Intelligenztest (ebenso bei Leistungsmotivation).<br />
– Allgemein:<br />
x hat die Eigenschaft E per Definition genau dann, wenn gilt: Falls x <strong>der</strong> Testbedingung<br />
S ausgesetzt wird, zeigt x die Reaktion R.<br />
Ein theoretischer Begriff soll also in seiner Bedeutung zurückgeführt werden auf<br />
bestimmte Beobachtungsbegriffe. In <strong>der</strong> Regel geht dies so, dass man ein Beobachtungs-<br />
o<strong>der</strong> Testverfahren einsetzt und es dann vom Beobachtungsergebnis<br />
abhängig macht, ob <strong>der</strong> theoretische Begriff dem betreffenden Objekt zugesprochen<br />
wird. Wichtig ist dabei, dass danach z.B. „Intelligenz” tatsächlich nichts ausdrücken<br />
soll, was über den gegebenen Test hinausginge.<br />
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass die Begriffe sehr präzise anwendbar werden.<br />
Und die Aussagen sind gut überprüfbar. Man nehme z.B. die Aussage: Franz hat<br />
eine überdurchschnittliche Intelligenz. Trifft das zu? Wenn <strong>der</strong> Messwert im Test<br />
über 100 liegt, trifft es zu. Man kann dann nicht die Frage stellen, ob Franz „wirklich”<br />
überdurchschnittlich intelligent ist, ob <strong>der</strong> Test „wirklich” Intelligenz misst. Das<br />
Messergebnis ist die Intelligenz. Ebenso kann man als Operationalist nicht mehr<br />
sagen: Das Magnetfeld <strong>der</strong> Erde bewirkt, dass die Kompassnadel ausschlägt. Wenn<br />
man die operationale Definition akzeptiert, dann ist das Magnetfeld nichts an<strong>der</strong>es<br />
als das Ausschlagen <strong>der</strong> Nadel.<br />
Hier zeigt sich bereits, dass die übliche Verwendung wissenschaftlicher Begriffe dem<br />
Operationalismus nicht entspricht. Man sagt gewöhnlich nicht, dass die theoretische<br />
und die beobachtbare Sache dasselbe wären. Soll man aus methodologischen<br />
Gründen künftig operationalistisch verfahren? Einen Vorteil hätte es:<br />
Wissenschaftliche Aussagen werden eindeutig durch Beobachtung prüfbar, denn sie<br />
beziehen sich jetzt alle auf so gut beobachtbare Sachverhalte wie Zeigerstellungen<br />
und Kreuze in einem Fragebogen. Aber das operationale Verfahren hat auch einen<br />
Preis. Es hat eine Reihe von merkwürdigen Folgen:<br />
– Man erhält eine Inflation von Begriffen. Jedes neue Beobachtungs- o<strong>der</strong><br />
Messverfahren führt einen neuen Begriff ein. Wir hätten nicht länger jeweils einen<br />
Begriff <strong>der</strong> Länge, Masse, Kraft usw., son<strong>der</strong>n so viele, wie es Messverfahren gibt.