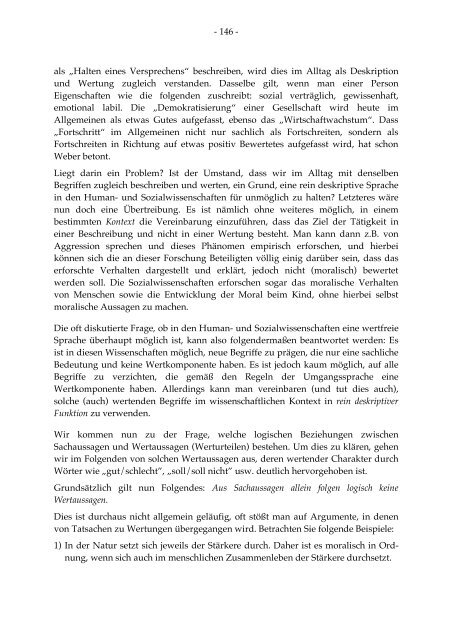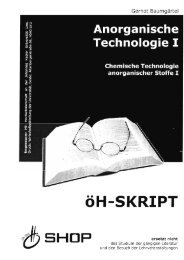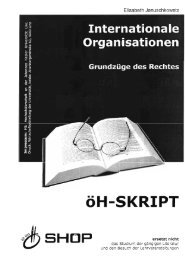Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 146 -<br />
als „Halten eines Versprechens“ beschreiben, wird dies im Alltag als Deskription<br />
und Wertung zugleich verstanden. Dasselbe gilt, wenn man einer Person<br />
Eigenschaften wie die folgenden zuschreibt: sozial verträglich, gewissenhaft,<br />
emotional labil. Die „Demokratisierung“ einer Gesellschaft wird heute im<br />
Allgemeinen als etwas Gutes aufgefasst, ebenso das „Wirtschaftwachstum“. Dass<br />
„Fortschritt“ im Allgemeinen nicht nur sachlich als Fortschreiten, son<strong>der</strong>n als<br />
Fortschreiten in Richtung auf etwas positiv Bewertetes aufgefasst wird, hat schon<br />
Weber betont.<br />
Liegt darin ein Problem? Ist <strong>der</strong> Umstand, dass wir im Alltag mit denselben<br />
Begriffen zugleich beschreiben und werten, ein Grund, eine rein deskriptive Sprache<br />
in den Human- und <strong>Sozialwissenschaften</strong> für unmöglich zu halten? Letzteres wäre<br />
nun doch eine Übertreibung. Es ist nämlich ohne weiteres möglich, in einem<br />
bestimmten Kontext die Vereinbarung einzuführen, dass das Ziel <strong>der</strong> Tätigkeit in<br />
einer Beschreibung und nicht in einer Wertung besteht. Man kann dann z.B. von<br />
Aggression sprechen und dieses Phänomen empirisch erforschen, und hierbei<br />
können sich die an dieser Forschung Beteiligten völlig einig darüber sein, dass das<br />
erforschte Verhalten dargestellt und erklärt, jedoch nicht (moralisch) bewertet<br />
werden soll. Die <strong>Sozialwissenschaften</strong> erforschen sogar das moralische Verhalten<br />
von Menschen sowie die Entwicklung <strong>der</strong> Moral beim Kind, ohne hierbei selbst<br />
moralische Aussagen zu machen.<br />
Die oft diskutierte Frage, ob in den Human- und <strong>Sozialwissenschaften</strong> eine wertfreie<br />
Sprache überhaupt möglich ist, kann also folgen<strong>der</strong>maßen beantwortet werden: Es<br />
ist in diesen Wissenschaften möglich, neue Begriffe zu prägen, die nur eine sachliche<br />
Bedeutung und keine Wertkomponente haben. Es ist jedoch kaum möglich, auf alle<br />
Begriffe zu verzichten, die gemäß den Regeln <strong>der</strong> Umgangssprache eine<br />
Wertkomponente haben. Allerdings kann man vereinbaren (und tut dies auch),<br />
solche (auch) wertenden Begriffe im wissenschaftlichen Kontext in rein deskriptiver<br />
Funktion zu verwenden.<br />
Wir kommen nun zu <strong>der</strong> Frage, welche logischen Beziehungen zwischen<br />
Sachaussagen und Wertaussagen (Werturteilen) bestehen. Um dies zu klären, gehen<br />
wir im Folgenden von solchen Wertaussagen aus, <strong>der</strong>en werten<strong>der</strong> Charakter durch<br />
Wörter wie „gut/schlecht”, „soll/soll nicht” usw. deutlich hervorgehoben ist.<br />
Grundsätzlich gilt nun Folgendes: Aus Sachaussagen allein folgen logisch keine<br />
Wertaussagen.<br />
Dies ist durchaus nicht allgemein geläufig, oft stößt man auf Argumente, in denen<br />
von Tatsachen zu Wertungen übergegangen wird. Betrachten Sie folgende Beispiele:<br />
1) In <strong>der</strong> Natur setzt sich jeweils <strong>der</strong> Stärkere durch. Daher ist es moralisch in Ordnung,<br />
wenn sich auch im menschlichen Zusammenleben <strong>der</strong> Stärkere durchsetzt.