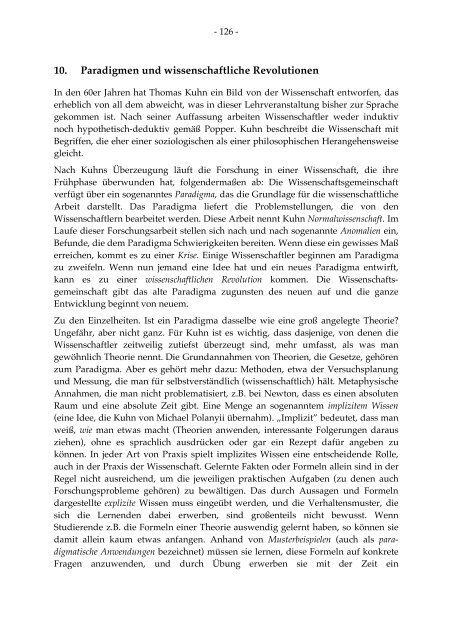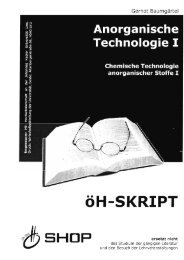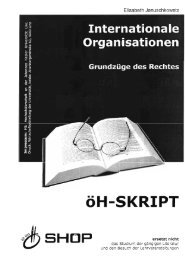Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 126 -<br />
10. Paradigmen und wissenschaftliche Revolutionen<br />
In den 60er Jahren hat Thomas Kuhn ein Bild von <strong>der</strong> Wissenschaft entworfen, das<br />
erheblich von all dem abweicht, was in dieser Lehrveranstaltung bisher zur Sprache<br />
gekommen ist. Nach seiner Auffassung arbeiten Wissenschaftler we<strong>der</strong> induktiv<br />
noch hypothetisch-deduktiv gemäß Popper. Kuhn beschreibt die Wissenschaft mit<br />
Begriffen, die eher einer soziologischen als einer philosophischen Herangehensweise<br />
gleicht.<br />
Nach Kuhns Überzeugung läuft die Forschung in einer Wissenschaft, die ihre<br />
Frühphase überwunden hat, folgen<strong>der</strong>maßen ab: Die Wissenschaftsgemeinschaft<br />
verfügt über ein sogenanntes Paradigma, das die Grundlage für die wissenschaftliche<br />
Arbeit darstellt. Das Paradigma liefert die Problemstellungen, die von den<br />
Wissenschaftlern bearbeitet werden. Diese Arbeit nennt Kuhn Normalwissenschaft. Im<br />
Laufe dieser Forschungsarbeit stellen sich nach und nach sogenannte Anomalien ein,<br />
Befunde, die dem Paradigma Schwierigkeiten bereiten. Wenn diese ein gewisses Maß<br />
erreichen, kommt es zu einer Krise. Einige Wissenschaftler beginnen am Paradigma<br />
zu zweifeln. Wenn nun jemand eine Idee hat und ein neues Paradigma entwirft,<br />
kann es zu einer wissenschaftlichen Revolution kommen. Die Wissenschaftsgemeinschaft<br />
gibt das alte Paradigma zugunsten des neuen auf und die ganze<br />
Entwicklung beginnt von neuem.<br />
Zu den Einzelheiten. Ist ein Paradigma dasselbe wie eine groß angelegte Theorie?<br />
Ungefähr, aber nicht ganz. Für Kuhn ist es wichtig, dass dasjenige, von denen die<br />
Wissenschaftler zeitweilig zutiefst überzeugt sind, mehr umfasst, als was man<br />
gewöhnlich Theorie nennt. Die Grundannahmen von Theorien, die Gesetze, gehören<br />
zum Paradigma. Aber es gehört mehr dazu: Methoden, etwa <strong>der</strong> Versuchsplanung<br />
und Messung, die man für selbstverständlich (wissenschaftlich) hält. Metaphysische<br />
Annahmen, die man nicht problematisiert, z.B. bei Newton, dass es einen absoluten<br />
Raum und eine absolute Zeit gibt. Eine Menge an sogenanntem implizitem Wissen<br />
(eine Idee, die Kuhn von Michael Polanyii übernahm). „Implizit” bedeutet, dass man<br />
weiß, wie man etwas macht (Theorien anwenden, interessante Folgerungen daraus<br />
ziehen), ohne es sprachlich ausdrücken o<strong>der</strong> gar ein Rezept dafür angeben zu<br />
können. In je<strong>der</strong> Art von Praxis spielt implizites Wissen eine entscheidende Rolle,<br />
auch in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Wissenschaft. Gelernte Fakten o<strong>der</strong> Formeln allein sind in <strong>der</strong><br />
Regel nicht ausreichend, um die jeweiligen praktischen Aufgaben (zu denen auch<br />
Forschungsprobleme gehören) zu bewältigen. Das durch Aussagen und Formeln<br />
dargestellte explizite Wissen muss eingeübt werden, und die Verhaltensmuster, die<br />
sich die Lernenden dabei erwerben, sind großenteils nicht bewusst. Wenn<br />
Studierende z.B. die Formeln einer Theorie auswendig gelernt haben, so können sie<br />
damit allein kaum etwas anfangen. Anhand von Musterbeispielen (auch als paradigmatische<br />
Anwendungen bezeichnet) müssen sie lernen, diese Formeln auf konkrete<br />
Fragen anzuwenden, und durch Übung erwerben sie mit <strong>der</strong> Zeit ein