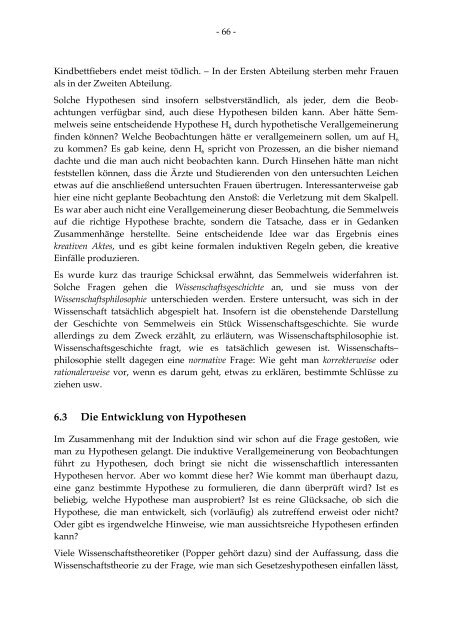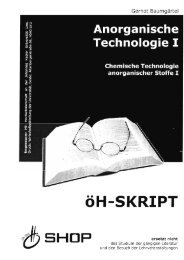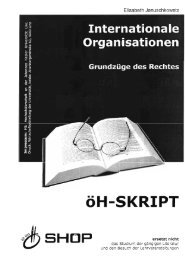Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 66 -<br />
Kindbettfiebers endet meist tödlich. – In <strong>der</strong> Ersten Abteilung sterben mehr Frauen<br />
als in <strong>der</strong> Zweiten Abteilung.<br />
Solche Hypothesen sind insofern selbstverständlich, als je<strong>der</strong>, dem die Beobachtungen<br />
verfügbar sind, auch diese Hypothesen bilden kann. Aber hätte Semmelweis<br />
seine entscheidende Hypothese H 6 durch hypothetische Verallgemeinerung<br />
finden können? Welche Beobachtungen hätte er verallgemeinern sollen, um auf H 6<br />
zu kommen? Es gab keine, denn H 6 spricht von Prozessen, an die bisher niemand<br />
dachte und die man auch nicht beobachten kann. Durch Hinsehen hätte man nicht<br />
feststellen können, dass die Ärzte und Studierenden von den untersuchten Leichen<br />
etwas auf die anschließend untersuchten Frauen übertrugen. Interessanterweise gab<br />
hier eine nicht geplante Beobachtung den Anstoß: die Verletzung mit dem Skalpell.<br />
Es war aber auch nicht eine Verallgemeinerung dieser Beobachtung, die Semmelweis<br />
auf die richtige Hypothese brachte, son<strong>der</strong>n die Tatsache, dass er in Gedanken<br />
Zusammenhänge herstellte. Seine entscheidende Idee war das Ergebnis eines<br />
kreativen Aktes, und es gibt keine formalen induktiven Regeln geben, die kreative<br />
Einfälle produzieren.<br />
Es wurde kurz das traurige Schicksal erwähnt, das Semmelweis wi<strong>der</strong>fahren ist.<br />
Solche Fragen gehen die Wissenschaftsgeschichte an, und sie muss von <strong>der</strong><br />
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> unterschieden werden. Erstere untersucht, was sich in <strong>der</strong><br />
Wissenschaft tatsächlich abgespielt hat. Insofern ist die obenstehende Darstellung<br />
<strong>der</strong> Geschichte von Semmelweis ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Sie wurde<br />
allerdings zu dem Zweck erzählt, zu erläutern, was <strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> ist.<br />
Wissenschaftsgeschichte fragt, wie es tatsächlich gewesen ist. Wissenschafts–<br />
philosophie stellt dagegen eine normative Frage: Wie geht man korrekterweise o<strong>der</strong><br />
rationalerweise vor, wenn es darum geht, etwas zu erklären, bestimmte Schlüsse zu<br />
ziehen usw.<br />
6.3 Die Entwicklung von Hypothesen<br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Induktion sind wir schon auf die Frage gestoßen, wie<br />
man zu Hypothesen gelangt. Die induktive Verallgemeinerung von Beobachtungen<br />
führt zu Hypothesen, doch bringt sie nicht die wissenschaftlich interessanten<br />
Hypothesen hervor. Aber wo kommt diese her? Wie kommt man überhaupt dazu,<br />
eine ganz bestimmte Hypothese zu formulieren, die dann überprüft wird? Ist es<br />
beliebig, welche Hypothese man ausprobiert? Ist es reine Glücksache, ob sich die<br />
Hypothese, die man entwickelt, sich (vorläufig) als zutreffend erweist o<strong>der</strong> nicht?<br />
O<strong>der</strong> gibt es irgendwelche Hinweise, wie man aussichtsreiche Hypothesen erfinden<br />
kann?<br />
Viele Wissenschaftstheoretiker (Popper gehört dazu) sind <strong>der</strong> Auffassung, dass die<br />
Wissenschaftstheorie zu <strong>der</strong> Frage, wie man sich Gesetzeshypothesen einfallen lässt,