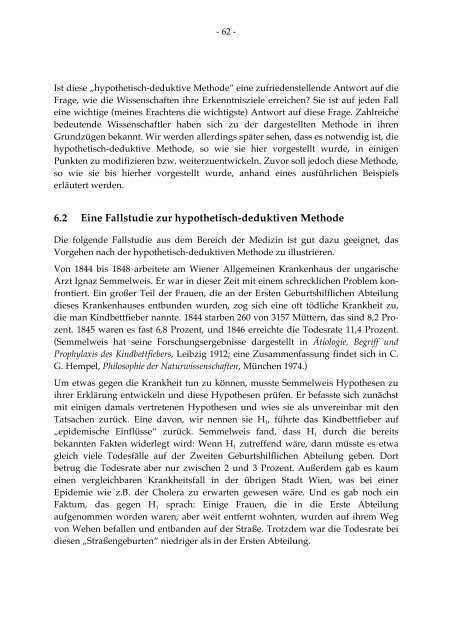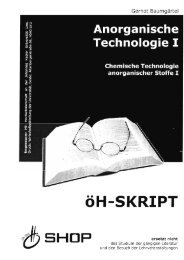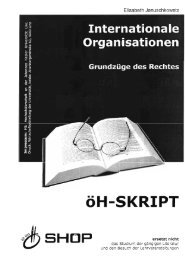Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 62 -<br />
Ist diese „hypothetisch-deduktive Methode” eine zufriedenstellende Antwort auf die<br />
Frage, wie die Wissenschaften ihre Erkenntnisziele erreichen? Sie ist auf jeden Fall<br />
eine wichtige (meines Erachtens die wichtigste) Antwort auf diese Frage. Zahlreiche<br />
bedeutende Wissenschaftler haben sich zu <strong>der</strong> dargestellten Methode in ihren<br />
Grundzügen bekannt. Wir werden allerdings später sehen, dass es notwendig ist, die<br />
hypothetisch-deduktive Methode, so wie sie hier vorgestellt wurde, in einigen<br />
Punkten zu modifizieren bzw. weiterzuentwickeln. Zuvor soll jedoch diese Methode,<br />
so wie sie bis hierher vorgestellt wurde, anhand eines ausführlichen Beispiels<br />
erläutert werden.<br />
6.2 Eine Fallstudie zur hypothetisch-deduktiven Methode<br />
Die folgende Fallstudie aus dem Bereich <strong>der</strong> Medizin ist gut dazu geeignet, das<br />
Vorgehen nach <strong>der</strong> hypothetisch-deduktiven Methode zu illustrieren.<br />
Von 1844 bis 1848 arbeitete am Wiener Allgemeinen Krankenhaus <strong>der</strong> ungarische<br />
Arzt Ignaz Semmelweis. Er war in dieser Zeit mit einem schrecklichen Problem konfrontiert.<br />
Ein großer Teil <strong>der</strong> Frauen, die an <strong>der</strong> Ersten Geburtshilflichen Abteilung<br />
dieses Krankenhauses entbunden wurden, zog sich eine oft tödliche Krankheit zu,<br />
die man Kindbettfieber nannte. 1844 starben 260 von 3157 Müttern, das sind 8,2 Prozent.<br />
1845 waren es fast 6,8 Prozent, und 1846 erreichte die Todesrate 11,4 Prozent.<br />
(Semmelweis hat seine Forschungsergebnisse dargestellt in Ätiologie, Begriff und<br />
Prophylaxis des Kindbettfiebers, Leibzig 1912; eine Zusammenfassung findet sich in C.<br />
G. Hempel, Philosophie <strong>der</strong> Naturwissenschaften, München 1974.)<br />
Um etwas gegen die Krankheit tun zu können, musste Semmelweis Hypothesen zu<br />
ihrer Erklärung entwickeln und diese Hypothesen prüfen. Er befasste sich zunächst<br />
mit einigen damals vertretenen Hypothesen und wies sie als unvereinbar mit den<br />
Tatsachen zurück. Eine davon, wir nennen sie H 1, führte das Kindbettfieber auf<br />
„epidemische Einflüsse“ zurück. Semmelweis fand, dass H 1 durch die bereits<br />
bekannten Fakten wi<strong>der</strong>legt wird: Wenn H 1 zutreffend wäre, dann müsste es etwa<br />
gleich viele Todesfälle auf <strong>der</strong> Zweiten Geburtshilflichen Abteilung geben. Dort<br />
betrug die Todesrate aber nur zwischen 2 und 3 Prozent. Außerdem gab es kaum<br />
einen vergleichbaren Krankheitsfall in <strong>der</strong> übrigen Stadt Wien, was bei einer<br />
Epidemie wie z.B. <strong>der</strong> Cholera zu erwarten gewesen wäre. Und es gab noch ein<br />
Faktum, das gegen H 1 sprach: Einige Frauen, die in die Erste Abteilung<br />
aufgenommen worden waren, aber weit entfernt wohnten, wurden auf ihrem Weg<br />
von Wehen befallen und entbanden auf <strong>der</strong> Straße. Trotzdem war die Todesrate bei<br />
diesen „Straßengeburten“ niedriger als in <strong>der</strong> Ersten Abteilung.