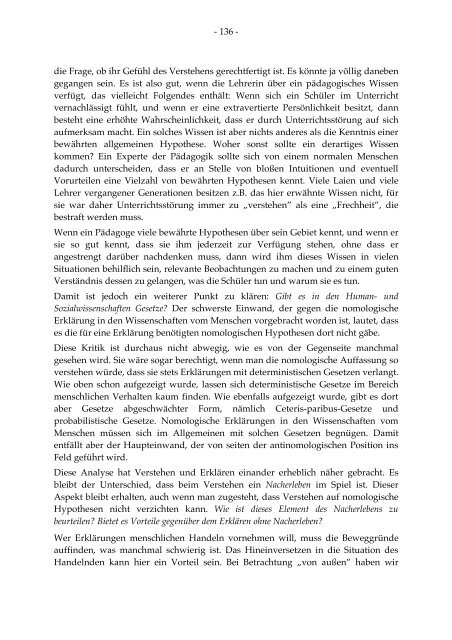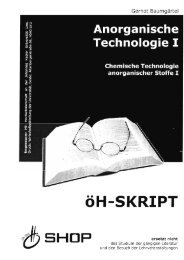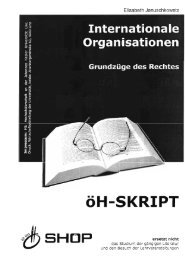Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 136 -<br />
die Frage, ob ihr Gefühl des Verstehens gerechtfertigt ist. Es könnte ja völlig daneben<br />
gegangen sein. Es ist also gut, wenn die Lehrerin über ein pädagogisches Wissen<br />
verfügt, das vielleicht Folgendes enthält: Wenn sich ein Schüler im Unterricht<br />
vernachlässigt fühlt, und wenn er eine extravertierte Persönlichkeit besitzt, dann<br />
besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er durch Unterrichtsstörung auf sich<br />
aufmerksam macht. Ein solches Wissen ist aber nichts an<strong>der</strong>es als die Kenntnis einer<br />
bewährten allgemeinen Hypothese. Woher sonst sollte ein <strong>der</strong>artiges Wissen<br />
kommen? Ein Experte <strong>der</strong> Pädagogik sollte sich von einem normalen Menschen<br />
dadurch unterscheiden, dass er an Stelle von bloßen Intuitionen und eventuell<br />
Vorurteilen eine Vielzahl von bewährten Hypothesen kennt. Viele Laien und viele<br />
Lehrer vergangener Generationen besitzen z.B. das hier erwähnte Wissen nicht, für<br />
sie war daher Unterrichtsstörung immer zu „verstehen” als eine „Frechheit”, die<br />
bestraft werden muss.<br />
Wenn ein Pädagoge viele bewährte Hypothesen über sein Gebiet kennt, und wenn er<br />
sie so gut kennt, dass sie ihm je<strong>der</strong>zeit zur Verfügung stehen, ohne dass er<br />
angestrengt darüber nachdenken muss, dann wird ihm dieses Wissen in vielen<br />
Situationen behilflich sein, relevante Beobachtungen zu machen und zu einem guten<br />
Verständnis dessen zu gelangen, was die Schüler tun und warum sie es tun.<br />
Damit ist jedoch ein weiterer Punkt zu klären: Gibt es in den Human- und<br />
<strong>Sozialwissenschaften</strong> Gesetze? Der schwerste Einwand, <strong>der</strong> gegen die nomologische<br />
Erklärung in den Wissenschaften vom Menschen vorgebracht worden ist, lautet, dass<br />
es die für eine Erklärung benötigten nomologischen Hypothesen dort nicht gäbe.<br />
Diese Kritik ist durchaus nicht abwegig, wie es von <strong>der</strong> Gegenseite manchmal<br />
gesehen wird. Sie wäre sogar berechtigt, wenn man die nomologische Auffassung so<br />
verstehen würde, dass sie stets Erklärungen mit deterministischen Gesetzen verlangt.<br />
Wie oben schon aufgezeigt wurde, lassen sich deterministische Gesetze im Bereich<br />
menschlichen Verhalten kaum finden. Wie ebenfalls aufgezeigt wurde, gibt es dort<br />
aber Gesetze abgeschwächter Form, nämlich Ceteris-paribus-Gesetze und<br />
probabilistische Gesetze. Nomologische Erklärungen in den Wissenschaften vom<br />
Menschen müssen sich im Allgemeinen mit solchen Gesetzen begnügen. Damit<br />
entfällt aber <strong>der</strong> Haupteinwand, <strong>der</strong> von seiten <strong>der</strong> antinomologischen Position ins<br />
Feld geführt wird.<br />
Diese Analyse hat Verstehen und Erklären einan<strong>der</strong> erheblich näher gebracht. Es<br />
bleibt <strong>der</strong> Unterschied, dass beim Verstehen ein Nacherleben im Spiel ist. Dieser<br />
Aspekt bleibt erhalten, auch wenn man zugesteht, dass Verstehen auf nomologische<br />
Hypothesen nicht verzichten kann. Wie ist dieses Element des Nacherlebens zu<br />
beurteilen? Bietet es Vorteile gegenüber dem Erklären ohne Nacherleben?<br />
Wer Erklärungen menschlichen Handeln vornehmen will, muss die Beweggründe<br />
auffinden, was manchmal schwierig ist. Das Hineinversetzen in die Situation des<br />
Handelnden kann hier ein Vorteil sein. Bei Betrachtung „von außen” haben wir