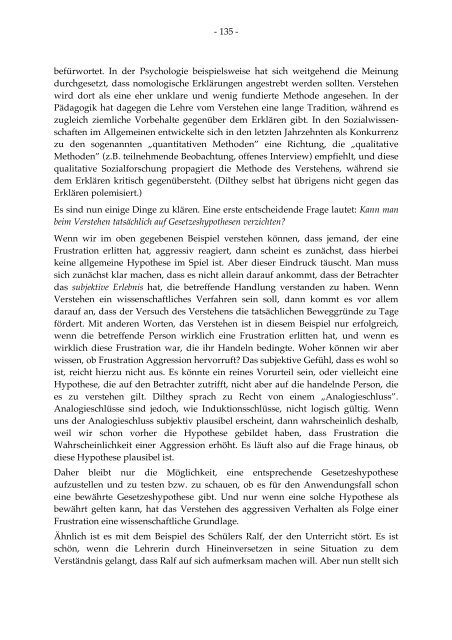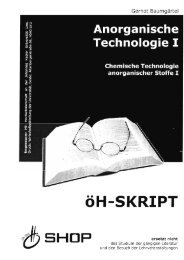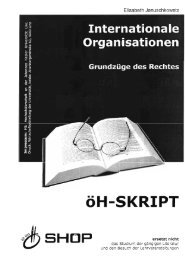Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 135 -<br />
befürwortet. In <strong>der</strong> Psychologie beispielsweise hat sich weitgehend die Meinung<br />
durchgesetzt, dass nomologische Erklärungen angestrebt werden sollten. Verstehen<br />
wird dort als eine eher unklare und wenig fundierte Methode angesehen. In <strong>der</strong><br />
Pädagogik hat dagegen die Lehre vom Verstehen eine lange Tradition, während es<br />
zugleich ziemliche Vorbehalte gegenüber dem Erklären gibt. In den <strong>Sozialwissenschaften</strong><br />
im Allgemeinen entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten als Konkurrenz<br />
zu den sogenannten „quantitativen Methoden” eine Richtung, die „qualitative<br />
Methoden” (z.B. teilnehmende Beobachtung, offenes Interview) empfiehlt, und diese<br />
qualitative Sozialforschung propagiert die Methode des Verstehens, während sie<br />
dem Erklären kritisch gegenübersteht. (Dilthey selbst hat übrigens nicht gegen das<br />
Erklären polemisiert.)<br />
Es sind nun einige Dinge zu klären. Eine erste entscheidende Frage lautet: Kann man<br />
beim Verstehen tatsächlich auf Gesetzeshypothesen verzichten?<br />
Wenn wir im oben gegebenen Beispiel verstehen können, dass jemand, <strong>der</strong> eine<br />
Frustration erlitten hat, aggressiv reagiert, dann scheint es zunächst, dass hierbei<br />
keine allgemeine Hypothese im Spiel ist. Aber dieser Eindruck täuscht. Man muss<br />
sich zunächst klar machen, dass es nicht allein darauf ankommt, dass <strong>der</strong> Betrachter<br />
das subjektive Erlebnis hat, die betreffende Handlung verstanden zu haben. Wenn<br />
Verstehen ein wissenschaftliches Verfahren sein soll, dann kommt es vor allem<br />
darauf an, dass <strong>der</strong> Versuch des Verstehens die tatsächlichen Beweggründe zu Tage<br />
för<strong>der</strong>t. Mit an<strong>der</strong>en Worten, das Verstehen ist in diesem Beispiel nur erfolgreich,<br />
wenn die betreffende Person wirklich eine Frustration erlitten hat, und wenn es<br />
wirklich diese Frustration war, die ihr Handeln bedingte. Woher können wir aber<br />
wissen, ob Frustration Aggression hervorruft? Das subjektive Gefühl, dass es wohl so<br />
ist, reicht hierzu nicht aus. Es könnte ein reines Vorurteil sein, o<strong>der</strong> vielleicht eine<br />
Hypothese, die auf den Betrachter zutrifft, nicht aber auf die handelnde Person, die<br />
es zu verstehen gilt. Dilthey sprach zu Recht von einem „Analogieschluss”.<br />
Analogieschlüsse sind jedoch, wie Induktionsschlüsse, nicht logisch gültig. Wenn<br />
uns <strong>der</strong> Analogieschluss subjektiv plausibel erscheint, dann wahrscheinlich deshalb,<br />
weil wir schon vorher die Hypothese gebildet haben, dass Frustration die<br />
Wahrscheinlichkeit einer Aggression erhöht. Es läuft also auf die Frage hinaus, ob<br />
diese Hypothese plausibel ist.<br />
Daher bleibt nur die Möglichkeit, eine entsprechende Gesetzeshypothese<br />
aufzustellen und zu testen bzw. zu schauen, ob es für den Anwendungsfall schon<br />
eine bewährte Gesetzeshypothese gibt. Und nur wenn eine solche Hypothese als<br />
bewährt gelten kann, hat das Verstehen des aggressiven Verhalten als Folge einer<br />
Frustration eine wissenschaftliche Grundlage.<br />
Ähnlich ist es mit dem Beispiel des Schülers Ralf, <strong>der</strong> den Unterricht stört. Es ist<br />
schön, wenn die Lehrerin durch Hineinversetzen in seine Situation zu dem<br />
Verständnis gelangt, dass Ralf auf sich aufmerksam machen will. Aber nun stellt sich