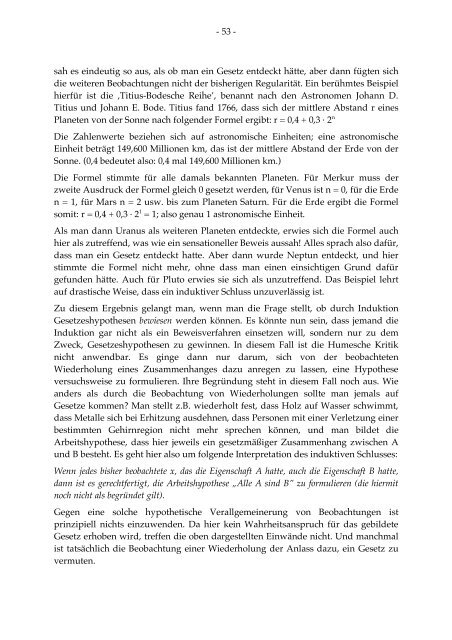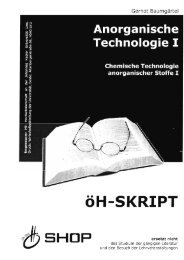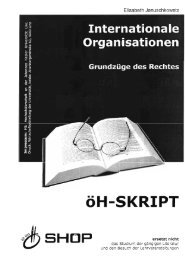Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 53 -<br />
sah es eindeutig so aus, als ob man ein Gesetz entdeckt hätte, aber dann fügten sich<br />
die weiteren Beobachtungen nicht <strong>der</strong> bisherigen Regularität. Ein berühmtes Beispiel<br />
hierfür ist die ‚Titius-Bodesche Reihe’, benannt nach den Astronomen Johann D.<br />
Titius und Johann E. Bode. Titius fand 1766, dass sich <strong>der</strong> mittlere Abstand r eines<br />
Planeten von <strong>der</strong> Sonne nach folgen<strong>der</strong> Formel ergibt: r = 0,4 + 0,3 · 2 n<br />
Die Zahlenwerte beziehen sich auf astronomische Einheiten; eine astronomische<br />
Einheit beträgt 149,600 Millionen km, das ist <strong>der</strong> mittlere Abstand <strong>der</strong> Erde von <strong>der</strong><br />
Sonne. (0,4 bedeutet also: 0,4 mal 149,600 Millionen km.)<br />
Die Formel stimmte für alle damals bekannten Planeten. Für Merkur muss <strong>der</strong><br />
zweite Ausdruck <strong>der</strong> Formel gleich 0 gesetzt werden, für Venus ist n = 0, für die Erde<br />
n = 1, für Mars n = 2 usw. bis zum Planeten Saturn. Für die Erde ergibt die Formel<br />
somit: r = 0,4 + 0,3 · 2 1 = 1; also genau 1 astronomische Einheit.<br />
Als man dann Uranus als weiteren Planeten entdeckte, erwies sich die Formel auch<br />
hier als zutreffend, was wie ein sensationeller Beweis aussah! Alles sprach also dafür,<br />
dass man ein Gesetz entdeckt hatte. Aber dann wurde Neptun entdeckt, und hier<br />
stimmte die Formel nicht mehr, ohne dass man einen einsichtigen Grund dafür<br />
gefunden hätte. Auch für Pluto erwies sie sich als unzutreffend. Das Beispiel lehrt<br />
auf drastische Weise, dass ein induktiver Schluss unzuverlässig ist.<br />
Zu diesem Ergebnis gelangt man, wenn man die Frage stellt, ob durch Induktion<br />
Gesetzeshypothesen bewiesen werden können. Es könnte nun sein, dass jemand die<br />
Induktion gar nicht als ein Beweisverfahren einsetzen will, son<strong>der</strong>n nur zu dem<br />
Zweck, Gesetzeshypothesen zu gewinnen. In diesem Fall ist die Humesche Kritik<br />
nicht anwendbar. Es ginge dann nur darum, sich von <strong>der</strong> beobachteten<br />
Wie<strong>der</strong>holung eines Zusammenhanges dazu anregen zu lassen, eine Hypothese<br />
versuchsweise zu formulieren. Ihre Begründung steht in diesem Fall noch aus. Wie<br />
an<strong>der</strong>s als durch die Beobachtung von Wie<strong>der</strong>holungen sollte man jemals auf<br />
Gesetze kommen? Man stellt z.B. wie<strong>der</strong>holt fest, dass Holz auf Wasser schwimmt,<br />
dass Metalle sich bei Erhitzung ausdehnen, dass Personen mit einer Verletzung einer<br />
bestimmten Gehirnregion nicht mehr sprechen können, und man bildet die<br />
Arbeitshypothese, dass hier jeweils ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen A<br />
und B besteht. Es geht hier also um folgende Interpretation des induktiven Schlusses:<br />
Wenn jedes bisher beobachtete x, das die Eigenschaft A hatte, auch die Eigenschaft B hatte,<br />
dann ist es gerechtfertigt, die Arbeitshypothese „Alle A sind B” zu formulieren (die hiermit<br />
noch nicht als begründet gilt).<br />
Gegen eine solche hypothetische Verallgemeinerung von Beobachtungen ist<br />
prinzipiell nichts einzuwenden. Da hier kein Wahrheitsanspruch für das gebildete<br />
Gesetz erhoben wird, treffen die oben dargestellten Einwände nicht. Und manchmal<br />
ist tatsächlich die Beobachtung einer Wie<strong>der</strong>holung <strong>der</strong> Anlass dazu, ein Gesetz zu<br />
vermuten.