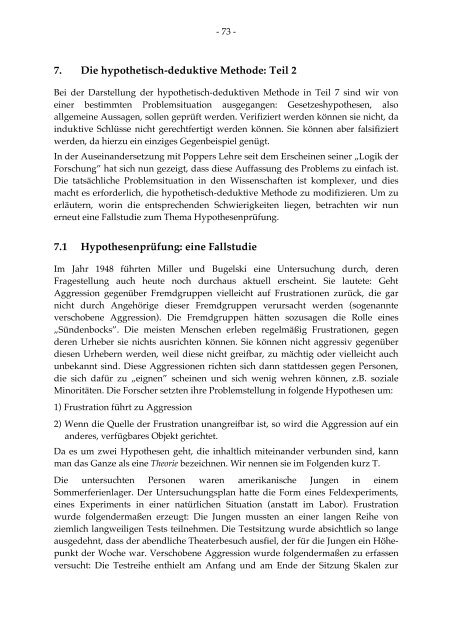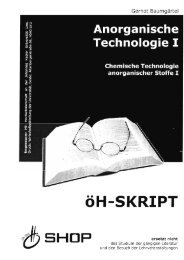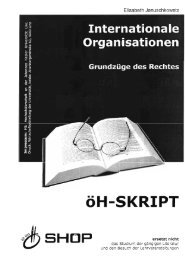Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 73 -<br />
7. Die hypothetisch-deduktive Methode: Teil 2<br />
Bei <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> hypothetisch-deduktiven Methode in Teil 7 sind wir von<br />
einer bestimmten Problemsituation ausgegangen: Gesetzeshypothesen, also<br />
allgemeine Aussagen, sollen geprüft werden. Verifiziert werden können sie nicht, da<br />
induktive Schlüsse nicht gerechtfertigt werden können. Sie können aber falsifiziert<br />
werden, da hierzu ein einziges Gegenbeispiel genügt.<br />
In <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Poppers Lehre seit dem Erscheinen seiner „Logik <strong>der</strong><br />
Forschung” hat sich nun gezeigt, dass diese Auffassung des Problems zu einfach ist.<br />
Die tatsächliche Problemsituation in den Wissenschaften ist komplexer, und dies<br />
macht es erfor<strong>der</strong>lich, die hypothetisch-deduktive Methode zu modifizieren. Um zu<br />
erläutern, worin die entsprechenden Schwierigkeiten liegen, betrachten wir nun<br />
erneut eine Fallstudie zum Thema Hypothesenprüfung.<br />
7.1 Hypothesenprüfung: eine Fallstudie<br />
Im Jahr 1948 führten Miller und Bugelski eine Untersuchung durch, <strong>der</strong>en<br />
Fragestellung auch heute noch durchaus aktuell erscheint. Sie lautete: Geht<br />
Aggression gegenüber Fremdgruppen vielleicht auf Frustrationen zurück, die gar<br />
nicht durch Angehörige dieser Fremdgruppen verursacht werden (sogenannte<br />
verschobene Aggression). Die Fremdgruppen hätten sozusagen die Rolle eines<br />
„Sündenbocks”. Die meisten Menschen erleben regelmäßig Frustrationen, gegen<br />
<strong>der</strong>en Urheber sie nichts ausrichten können. Sie können nicht aggressiv gegenüber<br />
diesen Urhebern werden, weil diese nicht greifbar, zu mächtig o<strong>der</strong> vielleicht auch<br />
unbekannt sind. Diese Aggressionen richten sich dann stattdessen gegen Personen,<br />
die sich dafür zu „eignen” scheinen und sich wenig wehren können, z.B. soziale<br />
Minoritäten. Die Forscher setzten ihre Problemstellung in folgende Hypothesen um:<br />
1) Frustration führt zu Aggression<br />
2) Wenn die Quelle <strong>der</strong> Frustration unangreifbar ist, so wird die Aggression auf ein<br />
an<strong>der</strong>es, verfügbares Objekt gerichtet.<br />
Da es um zwei Hypothesen geht, die inhaltlich miteinan<strong>der</strong> verbunden sind, kann<br />
man das Ganze als eine Theorie bezeichnen. Wir nennen sie im Folgenden kurz T.<br />
Die untersuchten Personen waren amerikanische Jungen in einem<br />
Sommerferienlager. Der Untersuchungsplan hatte die Form eines Feldexperiments,<br />
eines Experiments in einer natürlichen Situation (anstatt im Labor). Frustration<br />
wurde folgen<strong>der</strong>maßen erzeugt: Die Jungen mussten an einer langen Reihe von<br />
ziemlich langweiligen Tests teilnehmen. Die Testsitzung wurde absichtlich so lange<br />
ausgedehnt, dass <strong>der</strong> abendliche Theaterbesuch ausfiel, <strong>der</strong> für die Jungen ein Höhepunkt<br />
<strong>der</strong> Woche war. Verschobene Aggression wurde folgen<strong>der</strong>maßen zu erfassen<br />
versucht: Die Testreihe enthielt am Anfang und am Ende <strong>der</strong> Sitzung Skalen zur