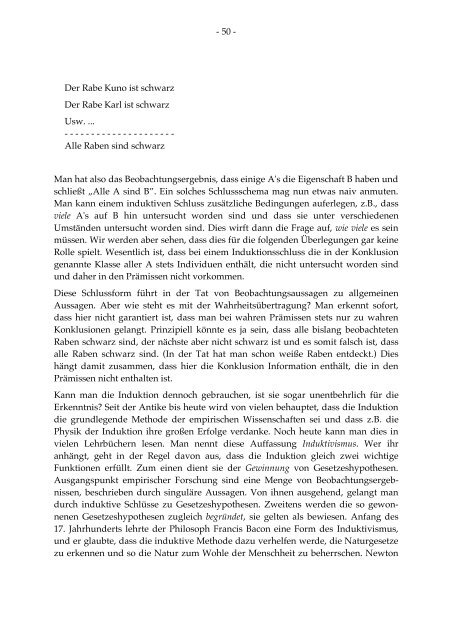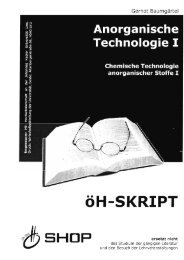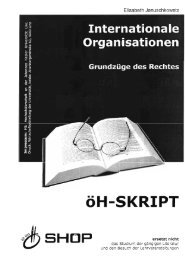Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Wissenschaftsphilosophie der Sozialwissenschaften - Open ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Rabe Kuno ist schwarz<br />
Der Rabe Karl ist schwarz<br />
Usw. ...<br />
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Alle Raben sind schwarz<br />
- 50 -<br />
Man hat also das Beobachtungsergebnis, dass einige A's die Eigenschaft B haben und<br />
schließt „Alle A sind B”. Ein solches Schlussschema mag nun etwas naiv anmuten.<br />
Man kann einem induktiven Schluss zusätzliche Bedingungen auferlegen, z.B., dass<br />
viele A's auf B hin untersucht worden sind und dass sie unter verschiedenen<br />
Umständen untersucht worden sind. Dies wirft dann die Frage auf, wie viele es sein<br />
müssen. Wir werden aber sehen, dass dies für die folgenden Überlegungen gar keine<br />
Rolle spielt. Wesentlich ist, dass bei einem Induktionsschluss die in <strong>der</strong> Konklusion<br />
genannte Klasse aller A stets Individuen enthält, die nicht untersucht worden sind<br />
und daher in den Prämissen nicht vorkommen.<br />
Diese Schlussform führt in <strong>der</strong> Tat von Beobachtungsaussagen zu allgemeinen<br />
Aussagen. Aber wie steht es mit <strong>der</strong> Wahrheitsübertragung? Man erkennt sofort,<br />
dass hier nicht garantiert ist, dass man bei wahren Prämissen stets nur zu wahren<br />
Konklusionen gelangt. Prinzipiell könnte es ja sein, dass alle bislang beobachteten<br />
Raben schwarz sind, <strong>der</strong> nächste aber nicht schwarz ist und es somit falsch ist, dass<br />
alle Raben schwarz sind. (In <strong>der</strong> Tat hat man schon weiße Raben entdeckt.) Dies<br />
hängt damit zusammen, dass hier die Konklusion Information enthält, die in den<br />
Prämissen nicht enthalten ist.<br />
Kann man die Induktion dennoch gebrauchen, ist sie sogar unentbehrlich für die<br />
Erkenntnis? Seit <strong>der</strong> Antike bis heute wird von vielen behauptet, dass die Induktion<br />
die grundlegende Methode <strong>der</strong> empirischen Wissenschaften sei und dass z.B. die<br />
Physik <strong>der</strong> Induktion ihre großen Erfolge verdanke. Noch heute kann man dies in<br />
vielen Lehrbüchern lesen. Man nennt diese Auffassung Induktivismus. Wer ihr<br />
anhängt, geht in <strong>der</strong> Regel davon aus, dass die Induktion gleich zwei wichtige<br />
Funktionen erfüllt. Zum einen dient sie <strong>der</strong> Gewinnung von Gesetzeshypothesen.<br />
Ausgangspunkt empirischer Forschung sind eine Menge von Beobachtungsergebnissen,<br />
beschrieben durch singuläre Aussagen. Von ihnen ausgehend, gelangt man<br />
durch induktive Schlüsse zu Gesetzeshypothesen. Zweitens werden die so gewonnenen<br />
Gesetzeshypothesen zugleich begründet, sie gelten als bewiesen. Anfang des<br />
17. Jahrhun<strong>der</strong>ts lehrte <strong>der</strong> Philosoph Francis Bacon eine Form des Induktivismus,<br />
und er glaubte, dass die induktive Methode dazu verhelfen werde, die Naturgesetze<br />
zu erkennen und so die Natur zum Wohle <strong>der</strong> Menschheit zu beherrschen. Newton