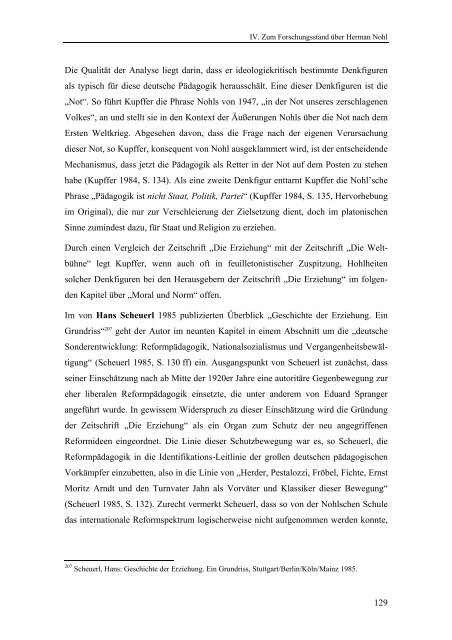Herman Nohl und die NS-Zeit
Herman Nohl und die NS-Zeit
Herman Nohl und die NS-Zeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
IV. Zum Forschungsstand über <strong>Herman</strong> <strong>Nohl</strong><br />
Die Qualität der Analyse liegt darin, dass er ideologiekritisch bestimmte Denkfiguren<br />
als typisch für <strong>die</strong>se deutsche Pädagogik herausschält. Eine <strong>die</strong>ser Denkfiguren ist <strong>die</strong><br />
„Not“. So führt Kupffer <strong>die</strong> Phrase <strong>Nohl</strong>s von 1947, „in der Not unseres zerschlagenen<br />
Volkes“, an <strong>und</strong> stellt sie in den Kontext der Äußerungen <strong>Nohl</strong>s über <strong>die</strong> Not nach dem<br />
Ersten Weltkrieg. Abgesehen davon, dass <strong>die</strong> Frage nach der eigenen Verursachung<br />
<strong>die</strong>ser Not, so Kupffer, konsequent von <strong>Nohl</strong> ausgeklammert wird, ist der entscheidende<br />
Mechanismus, dass jetzt <strong>die</strong> Pädagogik als Retter in der Not auf dem Posten zu stehen<br />
habe (Kupffer 1984, S. 134). Als eine zweite Denkfigur enttarnt Kupffer <strong>die</strong> <strong>Nohl</strong>’sche<br />
Phrase „Pädagogik ist nicht Staat, Politik, Partei“ (Kupffer 1984, S. 135, Hervorhebung<br />
im Original), <strong>die</strong> nur zur Verschleierung der Zielsetzung <strong>die</strong>nt, doch im platonischen<br />
Sinne zumindest dazu, für Staat <strong>und</strong> Religion zu erziehen.<br />
Durch einen Vergleich der <strong>Zeit</strong>schrift „Die Erziehung“ mit der <strong>Zeit</strong>schrift „Die Weltbühne“<br />
legt Kupffer, wenn auch oft in feuilletonistischer Zuspitzung, Hohlheiten<br />
solcher Denkfiguren bei den Herausgebern der <strong>Zeit</strong>schrift „Die Erziehung“ im folgenden<br />
Kapitel über „Moral <strong>und</strong> Norm“ offen.<br />
Im von Hans Scheuerl 1985 publizierten Überblick „Geschichte der Erziehung. Ein<br />
Gr<strong>und</strong>riss“ 207 geht der Autor im neunten Kapitel in einem Abschnitt um <strong>die</strong> „deutsche<br />
Sonderentwicklung: Reformpädagogik, Nationalsozialismus <strong>und</strong> Vergangenheitsbewältigung“<br />
(Scheuerl 1985, S. 130 ff) ein. Ausgangspunkt von Scheuerl ist zunächst, dass<br />
seiner Einschätzung nach ab Mitte der 1920er Jahre eine autoritäre Gegenbewegung zur<br />
eher liberalen Reformpädagogik einsetzte, <strong>die</strong> unter anderem von Eduard Spranger<br />
angeführt wurde. In gewissem Widerspruch zu <strong>die</strong>ser Einschätzung wird <strong>die</strong> Gründung<br />
der <strong>Zeit</strong>schrift „Die Erziehung“ als ein Organ zum Schutz der neu angegriffenen<br />
Reformideen eingeordnet. Die Linie <strong>die</strong>ser Schutzbewegung war es, so Scheuerl, <strong>die</strong><br />
Reformpädagogik in <strong>die</strong> Identifikations-Leitlinie der großen deutschen pädagogischen<br />
Vorkämpfer einzubetten, also in <strong>die</strong> Linie von „Herder, Pestalozzi, Fröbel, Fichte, Ernst<br />
Moritz Arndt <strong>und</strong> den Turnvater Jahn als Vorväter <strong>und</strong> Klassiker <strong>die</strong>ser Bewegung“<br />
(Scheuerl 1985, S. 132). Zurecht vermerkt Scheuerl, dass so von der <strong>Nohl</strong>schen Schule<br />
das internationale Reformspektrum logischerweise nicht aufgenommen werden konnte,<br />
207 Scheuerl, Hans: Geschichte der Erziehung. Ein Gr<strong>und</strong>riss, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1985.<br />
129