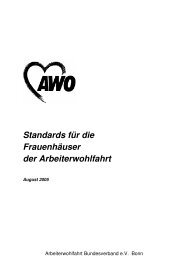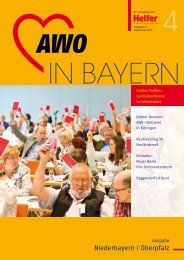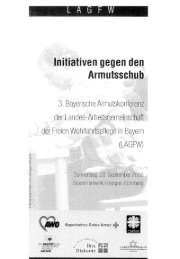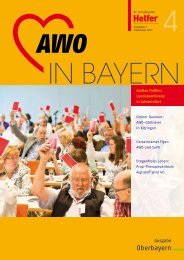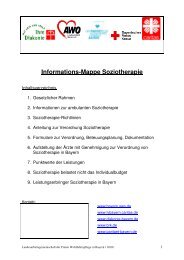Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
124<br />
Zu Punkt 2)<br />
Wir haben mit pädagogischen Fachkräften aus Kindertagesstätten<br />
<strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schullehrkräften sehr viele Gespräche<br />
<strong>und</strong> Diskussionen zum Thema Vorkurse<br />
(Deutsch 160) im Allgemeinen <strong>und</strong> zur Kooperation zwischen<br />
Kindergarten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schule im Speziellen geführt.<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten:<br />
– Die durch die Vorkurse vorgegebene Sprachförderung<br />
im letzten Jahr vor der Einschulung setzt viel zu<br />
spät an. Die Differenz in der Sprachkompetenz der<br />
Kinder kann nicht innerhalb eines Jahres aufgeholt<br />
werden. Eine spielerische, aber systematische <strong>und</strong><br />
kompetente (!) Förderung ab dem Alter von 3 Jahren<br />
wäre bei gleicher St<strong>und</strong>enzahl wesentlich effektiver,<br />
denn: Spracherwerb braucht Zeit. Nur so kann man<br />
zu einer Chancengleichheit zum Zeitpunkt der Einschulung<br />
kommen.<br />
– SowohlErzieher/innen als auch Gr<strong>und</strong>schullehrkräfte<br />
fühlen sich häufig durch die Aufgabe der Sprachförderung<br />
überfordert. Beide Seiten klagen über eigene<br />
fehlende Kompetenzen in Bezug auf das Deutsche<br />
als Zweitsprache (DaZ) mit noch nicht alphabetisierten<br />
Kindern. Materialschulungen gibt es zwar, aber an<br />
Kompetenzschulungen fehlt es. Eine gute Sprachförderung<br />
setzt ein hohes Maß an sprachlicher Bewusstheit<br />
auf Seiten der Förderkräfte voraus. Wenn diese<br />
nicht gegeben ist, beschränkt sich die Sprachförderung<br />
häufig auf ein Wortschatztraining – das ist zu wenig.<br />
– Die Kooperation zwischen Kindertagesstätten <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>schulen hat sich durch das BayKiBiG gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
verbessert, weil es sie vorher systematisch<br />
gar nicht gab (von engagierten Ausnahmen abgesehen).<br />
Es gibt mehr <strong>Sozial</strong>arbeit <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>schule<br />
hat im Vorfeld mehr Wissen über die Kinder, die sie im<br />
nächsten Schuljahr aufnimmt. Im Gegenzug lernen<br />
die Kinder das Umfeld Schule schon vor der Einschulung<br />
kennen. Hier geraten dann allerdings die deutschsprachigen<br />
Kinder ohne Sprachförderbedarf ins Hintertreffen.<br />
– InBezug auf die Inhalte <strong>und</strong> die Organisation der Vorkurse<br />
in der Kooperation beider Seiten sprechen die<br />
Fachkräfte noch von erheblichem Verbesserungsbedarf.<br />
In manchen Fällen funktioniert die Zusammenarbeit<br />
sehr gut, in vielen Fällen nicht. Gründe:<br />
• Die Organisation der Beförderung (Weg vom Kindergarten<br />
in die Schule <strong>und</strong> zurück) ist häufig sehr<br />
schwierig.<br />
• DieVorkurse in den Schulen liegen oft zu ungünstigen<br />
Zeiten.<br />
Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode Anhörung<br />
Wortprotokoll – vom Redner nicht autorisiert 82. S0, 27. 09. 2007<br />
• DieGruppen der Vorkurse in den Schulen sind zu<br />
groß.<br />
• Viele Erzieher/innen beklagen, dass Gr<strong>und</strong>schullehrkräfte<br />
die Kooperation „bestimmen“ <strong>und</strong> somit<br />
von einer echten Zusammenarbeit nicht die Rede<br />
sein kann. Konkrete Absprachen über Sprachförderkonzepte,<br />
-inhalte <strong>und</strong> –materialien fehlen.<br />
• Durch den im BayKiBiG festgelegten Buchungsschlüssel<br />
fehlen Verfügungszeiten auf Seiten der<br />
Erzieher/innen, was den Austausch erheblich erschwert,<br />
wenn nicht unmöglich macht.<br />
– Die gängigen Testverfahren (z.B. SISMIK) können<br />
nicht professionell durchgeführt <strong>und</strong> ausgewertet<br />
werden.<br />
– BisherigeAngebote der Gr<strong>und</strong>schulen <strong>für</strong> Kinder mit<br />
Sprachförderbedarf werden zu Gunsten der Vorkurse<br />
eingestellt.<br />
Zu Punkt 3)<br />
Um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen<br />
Erzieher/innen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schullehrkräften zu gewährleisten,<br />
wäre (mindestens) im Bereich der Vermittlung des<br />
Deutschen als Zweitsprache eine Vereinheitlichung in<br />
der Aus- oder Weiterbildung anzustreben. Denn – wie<br />
bereits erwähnt – sehen sich beide Seiten mit den gleichen<br />
Schwierigkeiten konfrontiert <strong>und</strong> fühlen sich häufig<br />
überfordert. Spracherwerb ist ein kontinuierlicher Prozess,<br />
den es kontinuierlich zu beobachten <strong>und</strong> zu unterstützen<br />
gilt. Der Sprachförderbedarf ist keinesfalls mit<br />
dem Schuleintritt abgeschlossen. Gr<strong>und</strong>sätzlich ist erforderlich,<br />
– diepädagogischen Kompetenzen beider Seiten anzugleichen<br />
– <strong>für</strong>den bewussten Umgang mit Sprache zu sensibilisieren;<br />
Wissen über Sprache aufzubauen (Wenn jemand<br />
eine Sprache spricht, bedeutet dies nicht automatisch,<br />
dass er sie auch vermitteln kann)<br />
– dasWechselverhältnis zwische Theorie <strong>und</strong> Praxis zu<br />
verbessern (Reflexion)<br />
– <strong>für</strong>Qualitätssicherung zu sorgen<br />
– inBezug auf Sprachstandserhebungsverfahren (Tests)<br />
zu schulen<br />
– regelmäßigeWeiterbidungen anzubieten