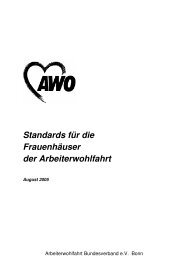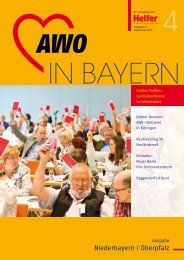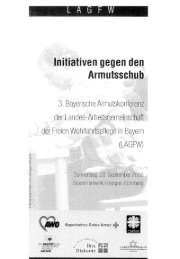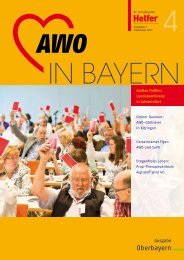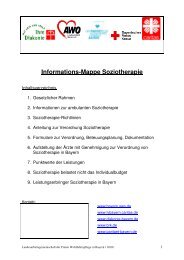Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anhörung Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode<br />
82. S0, 27. 09. 2007 Wortprotokoll – vom Redner nicht autorisiert<br />
Ich möchte darauf hinweisen, dass mit der Teilzeitbeschäftigung<br />
natürlich auch der Verdienst zurückgeht.<br />
Dies hat Herr Görres dankenswerterweise angesprochen.<br />
Ich habe die Arbeitsbedingungen in der Großtagespflege<br />
verglichen mit den Arbeitsbedingungen in<br />
der Kindertagesstätte <strong>und</strong> in der Krippe. Das können<br />
Sie in meiner umfangreichen Stellungnahme sehen.<br />
Dieser Vergleich macht deutlich, dass selbst eine Erzieherin<br />
mit einem vollen Arbeitsvertrag je nach steuerlichem<br />
Abzug unter Umständen weniger verdient als<br />
eine Tagesmutter, die eine Großtagespflege anbietet.<br />
Eine Erzieherin ist nicht ausgenommen von normalen<br />
weiblichen Schicksalen <strong>und</strong> bleibt ihr Leben lang verheiratet<br />
usw. Vielmehr kann es auch passieren, dass ihr der<br />
Mann wegläuft.<br />
(Vorsitzender Joachim Wahnschaffe (SPD): Dazu<br />
findet heute allerdings keine Anhörung statt.)<br />
Ja, genau. Das ist auch besser so. Ich will mich jetzt<br />
Frau Pauli nicht anschließen.<br />
(Heiterkeit)<br />
Dennoch ist es sehr bedenklich, dass wiederum Frauen<br />
stark von Armut betroffen sein werden, genauso deren<br />
Kinder, also Kinder von Erzieherinnen, die an der wichtigsten<br />
Stelle in der Gesellschaft arbeiten. Schaut man<br />
sich die Rente an, die diese Frauen zu erwarten haben,<br />
kann man sagen: Wer in der Kindertagesstätte arbeitet,<br />
läuft Gefahr, in die Armutsfalle zu geraten.<br />
(Vereinzelter Beifall)<br />
Dann möchte ich noch die Flexibilität hinsichtlich der<br />
Altersöffnung ansprechen. Große Einrichtungen, wie sie<br />
vor allem in Städten möglich sind, können in ihren Kindertagesstätten<br />
natürlich Kleingruppen mit Kleinkindern<br />
bilden. Von der Möglichkeit, unter Dreijährige in die Regelgruppe<br />
zu integrieren, machen vor allen Dingen Kindertagesstätten<br />
im ländlichen Raum Gebrauch, weil<br />
diese viel stärker von dem demoskopischen Wandel bedroht<br />
sind. Diese tun das entgegen ihrer pädagogischen<br />
Überzeugung.<br />
Sie haben heute die unter Zweijährigen angesprochen.<br />
Aber ich möchte die unter Dreijährigen einschließen. Ich<br />
glaube nicht, dass es einen Sinn hat, unter Dreijährige in<br />
Großgruppen zu integrieren. Es geht sogar so weit, dass<br />
die Konkurrenz im ländlichen Raum so groß ist, dass<br />
von drei Einrichtungen jede ein bis zwei unter Dreijährige<br />
aufnimmt, anstatt sich zusammenzutun <strong>und</strong> eine<br />
Kleingruppe zu bilden, wie es den unter Dreijährigen<br />
entsprechen würde. Stattdessen schnappt sich jeder<br />
diese Kinder, <strong>für</strong> die die Bedingungen sehr schlecht<br />
sind. Ich bezweifle sehr, dass es unter den Bedingungen<br />
– hierzu möchte ich eine Expertin zitieren, die das Staatsinstitut<br />
<strong>für</strong> Frühpädagogik leitet – möglich ist, „die Signale<br />
eines Kindes wahrzunehmen, diese richtig zu interpretieren<br />
<strong>und</strong> prompt sowie angemessen darauf zu<br />
reagieren <strong>und</strong> gleichzeitig sein Bedürfnis nach Selbstregulation<br />
<strong>und</strong> Selbstbestimmung zu respektieren“. Ich<br />
zitiere noch mal Frau Dr. Fabienne Becker-Stoll, die<br />
sagt: „Sichere Erzieherinnen-Kind-Bindungen entstehen<br />
in Kindergruppen, in denen die Gruppenatmosphäre<br />
durch ein empathisches Erzieherinnenverhalten bestimmt<br />
wird, das gruppenbezogen ausgerichtet ist <strong>und</strong><br />
die Dynamik in der Gruppensituation reguliert.“ Dieses<br />
Erzieherinnenverhalten, also dieses empathische Erzieherinnenverhalten,<br />
bildet sich besonders in kleinen stabilen<br />
Gruppen. Das brauchen die unter Dreijährigen. Wir<br />
können hier nicht von kleinen stabilen Gruppen sprechen,<br />
die uns zur Verfügung stehen <strong>und</strong> auch nicht von<br />
irgendeiner sicheren Perspektive, die Erzieherinnen<br />
hätten.<br />
Dann möchte ich auf die Gewichtungsfaktoren eingehen.<br />
Es ist tatsächlich ein Problem, dass nicht alle<br />
Kinder <strong>für</strong> alles einen Gewichtungsfaktor bekommen.<br />
Ich halte die Gewichtungsfaktoren <strong>für</strong> ungerecht. Man<br />
macht sie nicht gerechter, indem man neue schafft. Vielmehr<br />
sollte – das wurde auch schon angesprochen – der<br />
Anstellungsschlüssel zurückgehen. Wenn eine Personalkraft<br />
<strong>für</strong> acht Kinder zwischen drei bis sechs Jahren<br />
zuständig wäre, könnten die Gewichtungsfaktoren einfach<br />
entfallen, weil man allen Bedingungen gerecht<br />
werden könnte. Lediglich <strong>für</strong> Integration bräuchten wir<br />
dann noch Gewichtungsfaktoren. Für alle anderen Voraussetzungen<br />
bräuchten wir keine mehr, sei es, dass<br />
ein Kind nicht deutsch kann, in der Sprachentwicklung<br />
zurück ist oder die Mutter des Kindes Krebs bekommen<br />
hat, die Oma gestorben ist, ein Geschwisterchen geboren<br />
wurde, das Kind in die Schule geht oder zwei<br />
Jahre alt ist, wobei diese Altersgruppe andere Bedingungen<br />
braucht. Ich glaube, wir sollten davon wegkommen,<br />
Kinder in diese Kategorien zu stecken. Vielmehr<br />
haben alle Kinder ein Recht auf Integration, <strong>und</strong><br />
jedes Kind ist anders. Deshalb brauchen wir einen besseren<br />
Anstellungsschlüssel.<br />
Allerdings bildet der Anstellungsschlüssel nicht ab, wie<br />
viel Personal <strong>für</strong> die Kinder in der Gruppe zur Verfügung<br />
steht. Das ist schlecht. Denn wenn die Verfügungszeiten<br />
zurückgehen, müssen Dokumentation, Beobachtung,<br />
Elterngespräche <strong>und</strong> alles, was in einer Vorbereitungszeit<br />
oder der sogenannten Verfügungszeit getan wird,<br />
während der Zeit, in der Kinder da sind, getan werden.<br />
Es werden zum Teil Kinderpflegerinnen – das habe ich<br />
auf den Seiten des Ministeriums im Internet-Chat nachlesen<br />
dürfen – vier Wochen in der Gruppe alleine gelassen,<br />
ohne dass jemand krank ist, sondern weil die<br />
Leitung die Daten einpflegen muss. Da frage ich mich:<br />
Wie soll hier noch irgendein Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsziel<br />
umgesetzt werden? Wie soll da Qualität erreicht<br />
werden? Dies ist schlichtweg nicht möglich.<br />
Hier schließe ich an die erste Rednerin an. Es besteht<br />
die Gefahr, dass wir unter diesen Bedingungen zu Aufbewahrungsstätten<br />
werden. Das kann es nicht sein,<br />
auch wenn es sich nur um vier Wochen handelt. Es darf<br />
keinen Tag passieren.<br />
Genauso verhält es sich, wenn eine Kollegin die Sprachförderung<br />
macht <strong>und</strong> mit sechs Kindern aus der Gruppe<br />
geht. Dann sind immer noch 19 Kinder da, die auch ein<br />
Recht auf Bildung haben, die auch ein Recht haben in-<br />
35