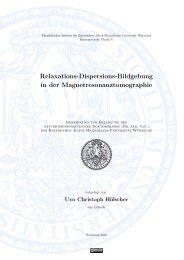Kirchliches Asylrecht und Kirchenasyl im demokratischen Rechtsstaat
Kirchliches Asylrecht und Kirchenasyl im demokratischen Rechtsstaat
Kirchliches Asylrecht und Kirchenasyl im demokratischen Rechtsstaat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anerkennung versagt. 83 Die Unabhängigkeit des Gesandten von der Macht des<br />
Aufnahmestaates konnte <strong>im</strong> Laufe der Zeit nur dann gerechtfertigt sein, wenn sie<br />
tatsächlich zur wirksamen Vertretung <strong>im</strong> fremden Land erforderlich war. Der Schutz für<br />
Straftäter - selbst wenn sie nicht zum Gefolge des Gesandten gehörten - war pr<strong>im</strong>a facie<br />
nicht innerhalb des Auftrags des Gesandten: es stand in gar keiner Beziehung zu seiner<br />
Mission, sondern widersprach ihr sogar, wenn der Gesandte seine Privilegien dazu<br />
benutzte, die Rechtsverfolgung <strong>im</strong> Aufnahmestaat zu hindern. 84<br />
Neben der Herleitung des diplomatischen Asyls aus dem innerstaatlichen Recht gab es<br />
auch Versuche, es unmittelbar aus dem Völkerrecht zu deduzieren. 85 Dem widersetzte<br />
sich unter anderen Autoren Grotius: Seiner Ansicht nach hinge die Frage, ob der Gesandte<br />
in seinem Hause Flüchtlingen ein Asyl gewähren dürfe, von der Bewilligung dessen ab,<br />
bei dem er beglaubigt sei; das Völkerrecht enthalte darüber keine allgemeine Regel. 86<br />
Im Laufe der Entwicklung des Völkerrechts wurden verschiedene Theorien entwickelt,<br />
welche die diplomatischen Vorrechte <strong>und</strong> Immunitäten betreffen <strong>und</strong> auch auf die<br />
Begründung diplomatischen Asyls von Einfluss sind.<br />
(2) Die Lehre von der Exterritorialität<br />
Das diplomatische Asyl könnte sich zunächst auf die Exterritorialität der Mission <strong>und</strong><br />
ihrer Räumlichkeiten stützen. Wenn ein Flüchtling die Botschaft erreichte, so könnte er<br />
an dieser Exterritorialität teilhaben.<br />
In der Neuzeit gelangte die Theorie der Exterritorialität des Gesandten selbst zum<br />
Durchbruch, d.h. der Gesandte war ab dem Zeitpunkt seiner Akkreditierung von der<br />
Herrschaft <strong>und</strong> Territorialgewalt des Aufnahmestaates frei. 87 Damit wird der tatsächliche<br />
Aufenthalt auf fremdem Gebiet aus rechtlicher Sicht negiert <strong>und</strong> gleichzeitig der<br />
fortbestehende Aufenthalt <strong>im</strong> Entsendestaat fingiert. 88 Nach Hugo Grotius 89 findet die<br />
Fiktion in zwei Richtungen statt. Zum einen gelten Gesandte als außerhalb des Landes<br />
wohnend (extra territorium), zum anderen sind sie ausschließlich dem Herrscher ihres<br />
He<strong>im</strong>atstaates unterworfen. Seit dem Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts traten an eine Örtlichkeit<br />
geb<strong>und</strong>ene Gesandtschaften auf. Nach <strong>und</strong> nach wurde die Unverletzlichkeit des<br />
Gesandten auf dessen Sitz (sog. Quartierfreiheit), Mobiliar, Fahrzeug <strong>und</strong> Gefolge<br />
83 Vgl. dazu Dann, S. 364 f.<br />
84 Vgl. Bulmerincq, S. 126.<br />
85 Vgl. Bulmerincq, S. 127.<br />
86 Schätzel (Hrsg.), Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, Zweites Buch, 18. Kapitel, VIII. 2., S. 315.<br />
87 Bulmerincq, S. 123 <strong>und</strong> 126.<br />
88 Bulmerincq, S. 124.<br />
89 Schätzel (Hrsg.), Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, Zweites Buch, 18. Kapitel, IV. 5., S. 312.<br />
47