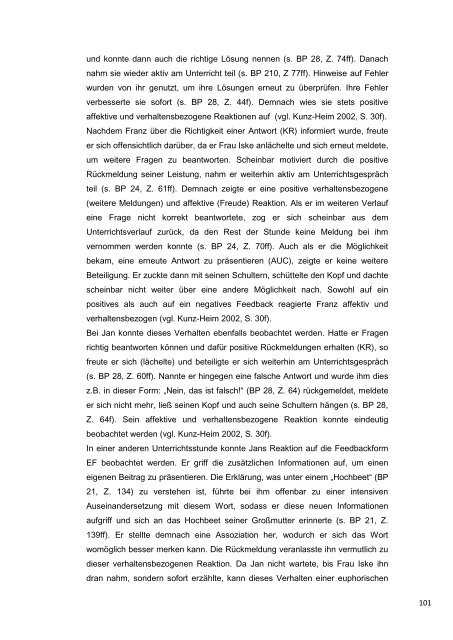Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und konnte dann auch die richtige Lösung nennen (s. BP 28, Z. 74ff). Danach<br />
nahm sie wieder aktiv am Unterricht teil (s. BP 210, Z 77ff). Hinweise auf Fehler<br />
wurden von ihr genutzt, um ihre Lösungen erneut zu überprüfen. Ihre Fehler<br />
verbesserte sie sofort (s. BP 28, Z. 44f). Demnach wies sie stets positive<br />
affektive und verhaltensbezogene Reaktionen auf (vgl. Kunz-Heim 2002, S. 30f).<br />
Nachdem Franz über die Richtigkeit einer Antwort (KR) informiert wurde, freute<br />
er sich offensichtlich darüber, da er Frau Iske anlächelte und sich erneut meldete,<br />
um weitere Fragen zu beantworten. Scheinbar motiviert durch die positive<br />
Rückmeldung seiner Leistung, nahm er weiterhin aktiv am Unterrichtsgespräch<br />
teil (s. BP 24, Z. 61ff). Demnach zeigte er eine positive verhaltensbezogene<br />
(weitere Meldungen) und affektive (Freude) Reaktion. Als er im weiteren Verlauf<br />
eine Frage nicht korrekt beantwortete, zog er sich scheinbar aus dem<br />
Unterrichtsverlauf <strong>zur</strong>ück, da den Rest der Stunde keine Meldung bei ihm<br />
vernommen werden konnte (s. BP 24, Z. 70ff). Auch als er die Möglichkeit<br />
bekam, eine erneute Antwort zu präsentieren (AUC), zeigte er keine weitere<br />
Beteiligung. Er zuckte dann mit seinen Schultern, schüttelte den Kopf und dachte<br />
scheinbar nicht weiter über eine andere Möglichkeit nach. Sowohl auf ein<br />
positives als auch auf ein negatives Feedback reagierte Franz affektiv und<br />
verhaltensbezogen (vgl. Kunz-Heim 2002, S. 30f).<br />
Bei Jan konnte dieses Verhalten ebenfalls beobachtet werden. Hatte er Fragen<br />
richtig beantworten können und da<strong>für</strong> positive Rückmeldungen erhalten (KR), so<br />
freute er sich (lächelte) und beteiligte er sich weiterhin am Unterrichtsgespräch<br />
(s. BP 28, Z. 60ff). Nannte er hingegen eine falsche Antwort und wurde ihm dies<br />
z.B. in dieser Form: „Nein, <strong>das</strong> ist falsch!“ (BP 28, Z. 64) rückgemeldet, meldete<br />
er sich nicht mehr, ließ seinen Kopf und auch seine Schultern hängen (s. BP 28,<br />
Z. 64f). Sein affektive und verhaltensbezogene Reaktion konnte eindeutig<br />
beobachtet werden (vgl. Kunz-Heim 2002, S. 30f).<br />
In einer anderen Unterrichtsstunde konnte Jans Reaktion auf die Feedbackform<br />
EF beobachtet werden. Er griff die zusätzlichen Informationen auf, um einen<br />
eigenen Beitrag zu präsentieren. Die Erklärung, was unter einem „Hochbeet“ (BP<br />
21, Z. 134) zu verstehen ist, führte bei ihm offenbar zu einer intensiven<br />
Auseinandersetzung mit diesem Wort, so<strong>das</strong>s er diese neuen Informationen<br />
aufgriff und sich an <strong>das</strong> Hochbeet seiner Großmutter erinnerte (s. BP 21, Z.<br />
139ff). Er stellte demnach eine Assoziation her, wodurch er sich <strong>das</strong> Wort<br />
womöglich besser merken kann. Die Rückmeldung veranlasste ihn vermutlich zu<br />
dieser verhaltensbezogenen Reaktion. Da Jan nicht wartete, bis Frau Iske ihn<br />
dran nahm, sondern sofort erzählte, kann dieses Verhalten einer euphorischen<br />
101